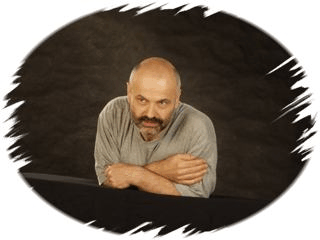|
Das Apollinische und das Dionysische
|
bei Friedrich Nietzsche
Im 19. Jahrhundert kreuzen sich die Gedankengänge aller bis dahin bekannten Welträume und aller bis dahin bekannten Zeiten auf eine Weise, die uns Heutigen atemberaubend erscheint. Sie reicht von Goethes Begriff der Weltliteratur bis hin zur Entdeckung des Tuberkelbazillus und der Elektro- und Verbrennungsmotoren. Ein Blick zurück auf dieses bemerkenswerte historische Ereignisjahrhundert eröffnet uns erstaunliche Gedankenleistungen, die von da an auch ihre Bedingtheit in der Wirklichkeit suchen und sich sogar dahin versteigen, das Geschichtliche, dieses bis heute undefinierbar Ungebändigte, in all seinen gesellschaftlichen Strukturebenen unter die Herrschaft des Geistes zu zwingen. Die ersten Beschreibungen des historischen Materialismus sind durchaus ernstzunehmende Versuche, die, allen Unkenrufen aus der Ecke der Halbgebildeten zum Trotz, bei weitem noch nicht abgegolten sind. Sie sind Teil des universalen Traums der Menschen, Herr ihrer geschichtlichen Existenz zu sein, das Technische, das Ökonomische, das Kulturelle, das Politische und das Wissenschaftliche mit einem Gesetzesbegriff fassen und es damit durch Wiederholbarkeit steuern zu können.
Im 19. Jahrhundert rauchten die Schlote, und alle waren hocherfreut darüber. Die Arbeiter schufteten bis zur buchstäblichen Erschöpfung, was für normal galt, denn sie waren nun einmal Arbeiter. Ihre Altersgrenze lag nicht höher als 35 Jahre, ein 50jähriger Arbeiter galt als Methusalem. Mitten in dieses chaotisch scheinende Jahrhundert mit seinen Erfindungen, Kriegen, Entdeckungen, künstlerischen Errungenschaften und wissenschaftlichen Höchstleistungen wurde 1844 Friedrich Nietzsche geboren, der es wie kein anderer verstand, seiner Orientierungslosigkeit Ausdruck zu geben. In ihm wuchs ein Sprachgenie von außergewöhnlichen Graden heran. Doch war es ihm nicht gegeben, zu einer einigermaßen systematischen Denkleistung vorzudringen. Er sah das frühzeitig bei seiner Kapitulation als Philologe selbst: Das Malheur nämlich ist, ich habe keine Muster und bin in der Gefahr des Narren auf eigene Hand. (Brief an Rohde, Januar - Februar 1870, III,94,57) Wohl bedachte er viel, und was er durch seinen Kopf schleuste gewann zugespitzte Eindringlichkeit. Doch es hatte keine schlüssige Form, es war nach allen Seiten offen, von jedem für alles deutbar. Viele seiner begeisterten Leser suchen in ihm den unverstandenen Philosophen schlechthin, obwohl er doch eigentlich der Sucher mitten in der für ihn zum Labyrinth gewordenen philosophischen Unverständlichkeit war. Nietzsche schien jedem seiner Leser das geben zu können, was einer nur aus aphoristischen Glanzformulierungen und dunklen Wortnebeln herausdeuteln wollte. Im gleichen aufschlussreichen Brief an Rohde kraftmeiert er naiv: ..litterarischen Ehrgeiz habe ich eigentlich gar nicht, an eine herrschende Schablone mich anzuschließen brauche ich nicht, weil ich keine glänzenden und berühmte Stellungen erstrebe. Dagegen will ich mich, wenn es Zeit ist, so ernst und freimüthig äußern, wie nur möglich. Wissenschaft Kunst und Philosophie wachsen jetzt so sehr in mir zusammen, dass ich jedenfalls einmal Centauren gebären werde. Kentauren, das waren Doppelwesen aus Menschlichem und Tierischem, Missgeburten eigentlich in einem mythisch positiven Sinn, wo sie Natur und Kultur in einem Körper verbanden. Nietzsche wird sich immer mit diesen synthetischen Wesen identifizieren. Er selbst projeziert sich zum Vater dieser Zwittergeschöpfe und ist von ihrer und der ihm eigenen Beschaffenheit zerrissen, und er wird nur immer wieder Wesen mit menschlichen Köpfen und tierischer Körpern zeugen. Er wird ein im Gestus protestantischer Eiferer predigender Gedankenalchimist bleiben, er wird das Gold aus einem Konglomerat der Kunst, Wissenschaft und Philosophie suchen und das feine Porzellan einer überragenden essayistischen Prosa finden.
Noch heute gibt es neben Leuten, die sich an der Glätte des Nietzsche-Stils bis zum schwindelerregenden Trübsinn berauschen, auch solche, die seine Texte zwar nicht gelesen haben, doch ganz genau wissen, was er meinte, wenn sie mit irgendwelchen aufgeschnappten Satzbrocken um sich werfen und dem tief empfundenen Flachsinn huldigen, indem sie unverstandene Sprüche wiederkäuen. Nietzsche, so meinen sie, das sei der große Philosoph, der die Warnung aussprach, dass der Mann zum Weibe nicht ohne Peitsche gehen solle, der den Übermenschen erfunden habe und der vom Schicksal zur Verkündigung der bedeutenden Lehre von der immerwährenden Wiederkunft des Gleichen erkoren worden sei. Ein bedeutsamer Seufzer folgt in aller Regel und die Bestätigung, wie wahr der Meister doch in seinen Werken gesprochen habe.
An derartigem Blödsinn wollen wir uns heute nicht beteiligen. Wir wollen sogar jenen Friedrich Nietzsche noch nicht einmal für einen Philosophen halten. Nehmen wir ihn als einen Essayisten. Das ist eine sehr seltene Art unter den Schriftstellern, die seit den Zeiten des Humanismus und der Aufklärung alles Menschenmögliche, auch Philosophisches neu bedachte und ihre komprimierten Denkspiele in eine für Zeitgenossen und nachfolgende Generationen verbindliche Sprache fasste. Diese bestenfalls im Rhythmus von Jahrhunderthälften auftretenden Schriftsteller wurden vor allem Anreger in den geistigen Auseinandersetzungen ihrer Zeiten. Sie waren scharfsinnige Zweifler, deren Texte auch heute kaum angetan sind, einen Beitrag zur Verständlichkeit unserer Welt zu leisten. Vielmehr aber säen sie den Zweifel und wecken die Vernunft. Und aus diesem Grund ist es nicht schädlich, sie auch für Philosophen zu halten, wenngleich sie als geistige Versucher letztlich keine waren.
Wir schauen gern zu den bequemen Essayisten der Franzosen und den flüssig zu lesenden der Briten und Nordamerikaner, nennen allen voran Michel de Montaigne und Charles de Montesquieu oder Samuel Johnson und Francis Bacon, wir verschließen nicht den Blick vor Ralph Waldo Emerson oder Henry David Thoreau und wissen sie gelegentlich sogar zu würdigen. Unsere eigenen Essayisten aber, die zugegebenermaßen mit ihren äußerst sperrigen Gedankengängen nicht immer einfach zu lesen sind, von Ulrich von Hutten, Mutianus Rufus, Eobanus Hessus über Gotthold Ephraim Lessing, die beiden Humboldts zu Arthur Schopenhauer, sind den meisten Lesern bestenfalls nur dem Namen nach bekannt. Dazwischen liegen Welten, die nur nach ihren Gipfeln Böhme, Leibniz, Herder, Goethe, Hegel, Schelling und Feuerbach zu nennen unübersehbar anmutet. Von da aus kommen wir zu unserem Friedrich Nietzsche, der als Altphilologe alle geistigen Hauptgipfel der griechischen Antike von Platon bis zu den Stoikern bestiegen und sich mehr oder weniger erfolgreich sogar an einigen Kirchenvätern versucht hatte. Sein Hauptaugenmerk galt jedoch seiner ein wenig zornigen Art gemäß der Zeitkritik, also dem, was ihm im 19. Jahrhundert unter die Augen und Ohren kam. Diese beiden Sinnesorgane sind für ihn prägend. In Nietzsche haben wir einen Literaturkenner vor uns, aber ebenso auch einen sehr verständigen Musikliebhaber. Und so ist es nicht verwunderlich, dass seine erste öffentlichkeitswirksame Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik heißt. Aus diesem Text von 1872 stammt auch das kentaurenhafte Begriffspaar Apollinisches und Dionysisches, das seit dem ersten Tag der Bekanntgabe auch mit in den Sabbelkrug gehört, aus dem bis auf den heutigen Tag immer wieder frisch der Schwafelextrakt geschöpft wird, der dann je nach wohlfeiler Gelegenheit bis zur Geschmacklosigkeit verdünnt im Buchhandel oder im ewigen Bestand der neometaphysischen deutschen Kathederrhetorik erscheint.
Immer wieder gibt es einmal zu lesen, dass Nietzsche es vermochte, mit dem Begriffspaar Apollinisch und Dionysisch die menschliche Doppelnatur zu beschreiben, die zwei Seelen, ach! in jeder deutschen Brust, hie die dem Apoll plagiativ entraubte Klarheit der schönen Formen und des tiefen Denkens, da das dem Dionys zugeschobene rauschhaft Nebelwarme, dieses, was nicht gern besprochen wird in vornehmen Kreisen, das aber doch immer wieder drohend kommt und wofür angeblich keiner außer Siegmund Freud etwas kann. Apoll, so schwören sie gelegentlich, sei der Gott des Lichtes, der überschaubaren Ordnung und des vollendeten Strebens; Dionys hingegen nehmen sie als Inbegriff des Besoffenseins und all der damit verbundenen traurigen Konsequenzen, von selbstvergessenem Taumel, schwärmerischem Rausch, dunkel getriebener Leidenschaft und natürlich der hemmungslosen Fronarbeit im sexuellen Wahn - was auch immer sie neben Fruchtbarkeit darunter verstehen. Apoll sei, so sagen sie, der Repräsentant des Artigen, Dionys der mit dem Schweinskram. Um dem Antipoden-Konstrukt einen sentimentalen Sinn zu stiften, stopfen viele Autoren in den freigeschlagenen Raum die Kunst, denn irgendwo dazwischen, so vermuten sie, entspränge sie, einerseits die sich aus dem gottgegebenen Regelmaß ableitenden Bildkunst, andererseits die dem Ungeregelten zugängliche Kunst der Musik und andere niedere Reizmittel. Die apollinisch klare, die luzid vergeistigte Kunst für die höheren Menschen und die versaute dionysische für den Rest, der eh nur mit dem Unterleib denkt. Manche gehen sogar so weit, die Menschheit zu katalogisieren, dieser Teil ins Apoll-Töpfchen und jene Masse ins Dionys-Kröpfchen. Die Metaphysik der Beliebigkeit gibt jedem das, was er braucht, wenn er es haben will.
Hand aufs Herz, wer soll da mitreden, wenn er nicht weiß, wer oder was mit Apoll und Dionys gemeint ist. Das wissen selbst die heutigen Griechen nicht mehr so genau. Es gibt professorale Jongleure, denen diese Begriffe Anlass zu weitschweifigen Auslegungen sind. Das Gute ist, sie sind ideologisch nicht vorbelastet, apollinisch ist nicht automatisch links oder rechts, und dionysisch ist weder papstfeindlich noch marxistisch. Aber sie sind auf ziemlich seltsame Art zu Wertbegriffen geworden. Doch wer hat Nietzsches Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik gelesen. Für die meisten von uns ist sie so weit entfernt wie die Götter Griechenlands. Und mit denen kann einer, der eine Familie hat, eine, die gelegentlich Hunger verspürt und für deren Unterkunft Miete gezahlt werden muss, keinen Blumentopf gewinnen. Da wir uns aber diesem vor uns liegenden Gedankenknäuel aus Wissensdurst nähern, liegt ein Motiv nahe, und es gibt keinen Grund, länger im Stadium des Zweifels zu schmachten. Die konstruierte Polarität zwischen Apollon und Dionysos soll nach unserem heutigen Verständnis auf Friedrich Nietzsche zurückgehen. Das meinen viele und es ist im Prinzip auch wahr, denn vor dem Basler Professor hat niemand so ein ekstatisches Gewese darum gemacht. Und trotzdem hatten sowohl Goethe als auch Heine und andere sich schon vor Nietzsche mit dem Thema befasst. Nietzsche allein trug es über die ihm angestammten Kunstgrenzen hinaus und errichtete eine zwar schön anzuschauende, doch recht eigentlich wacklige, mit Bastschnüren und Holznägeln zusammengehaltene Weltanschauung daraus. Er posaunte im Grunde, um im Bild zu bleiben, dionysisch unbekümmert heraus, womit sich die Psychologen, Philosophen, Philologen, Künstler und Kunsttheoretiker, Archäologen und Theologen für sich im Stillen beschäftigten. Wir wollen nun schauen, was Nietzsche meinte, als er ein Begriffspaar antinomisch zueinanderstellte, das in der wissenschaftlichen Beschäftigung bis dahin und selbst in der Antike nicht als widersprüchlich aufgefasst wurde. Es wäre auch interessant, zu erfahren, wer dann nach Nietzsche mit diesen Begriffen in seinem oder auch gegen seinen Sinn operierte. Und zum Schluss könnten wir dem Ganzen die Krone aufsetzen und fragen, was diese Begriffe uns heute eigentlich noch bedeuten.
Wir wollen dabei unverkrampft heranzugehen versuchen, weil dieser Bereich des menschlichen Wissens in seiner abgehobenen Deutelei eine schon komisch zu nennende Qualität an Verworrenheit erreicht hat, die aufzudröseln erstens hoffnungslos und zweitens völlig unnütz wäre. Ich schließe mich dem Literaturhistoriker Erich Heller an: Der gelehrte Versuch, den Komplex von historischen Erinnerungen, Symbolen, Einsichten und Gefühlen, der die Geschichte von Dionysos, Apollo und Orpheus im Denken und Dichten der neueren Zeit formt, zu entwirren, und dann etwa auch noch mit dem Bild zu vergleichen, das sich die Griechen selber von diesen göttlichen Wesen gemacht haben, ist so heroisch wie er vergeblich ist. Denn der behutsame Gang des Gelehrten kann unmöglich mit dem Wirbeltanz der Leidenschaften des Geistes Schritt halten, der um jene Namen sich dreht und nur auf Augenblicke in ungezählten Figurationen zum Stillstand kommt.(E. Heller, Enterbter Geist. Essays über modernes Dichten und Denken, Frankfurt - M. 1954, 192f.)
Greifen wir uns - Sie werden sich an Ihre interessanten Philosophie- und Ästhetik-Seminare erinnern - einmal nur zwei Beispiele heraus um zu prüfen, was vorher war. Johann Wolfgang von Goethe und Georg Friedrich Wilhelm Hegel hatten es auch mit Apoll und Dionys, der eine in einer harmonisierend klassizistischen Weise, indem er vom Naturerlebnis ausgehend postuliert, die Kunst hebe einen Gegenstand aus einer beschränkten Wirklichkeit hervor, obwohl dies selbstverständlich bloße Nachahmung verbiete, denn, wie er schrieb, die Verdopplung der Natur durch die Kunst hieße, Natur und Idee zu trennen, und damit sowohl die Kunst als auch das Leben zu zerstören und belegt das mit dem Beispiel des künstlerisch kopierten Hundes, die, wenn die Nachahmung auch gut geraten sei, ja doch nur zwei Bellos für einen geschaffen habe.(vgl. G, Der Sammler u. d. Seinigen, HA,XII,82) Wenn aber der Künstler etwas den Erscheinungen der Natur Ähnliches (Einl. i. d. Prop., HA, XII,42) hervorbringt, erschafft er seinen Gegenstand selbst, indem er ihn das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt und einen höheren Wert hineinlegt(ebd.,46) und so durch Annäherung das Göttliche in den Dingen ausdrückt, das wir nicht kennen würden, wenn der mensch es nicht fühlte und selbst hervorbrächte (vgl. G, Der Sammler u. d. Seinigen, HA,XII,84). Als Vermittlerin des Unaussprechlichen ruhe, so Goethe, die Kunst auf einer Art religiösem Sinn(vgl. MuR, HA,XII,468). Ihre höchste stilbildende Stufe sei dann erreicht, wenn sie sowohl die einfache Nachahmung der Natur, nämlich die Behandlung beschränkter Gegenstände, als auch das Subjektive der Arbeitsweise des jeweiligen Künstlers hinter sich lässt und vielmehr die Eigenschaften der Dinge, die Art, wie sie bestehen, darstelle. Dann ruhe die Kunst auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, sofern uns erlaubt sei, es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen.(G, Einfache Nachahmung...,HA,XII,31f.)
In Goethes kunsttheoretisch gedachter Novelle Der Sammler und die Seinigen von 1799, am Ende seiner hochklassischen Phase, gibt es folgenden eigenartigen Dialog zwischen dem Arzt und Besitzer des Kunstkabinetts und dem Fremden, der die Manieristen verabscheut:
(Der Fremde: Sie sind denn also auch den hergebrachten Grundsätzen getreu, daß Schönheit das letzte Ziel der Kunst sei?
Mir ist kein höheres bekannt, versetzte ich darauf.
Können Sie mir sagen, was Schönheit sei? rief er aus.
Vielleicht nicht! versetzte ich, aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gipsabguß des Apolls, einen sehr schönen Marmorkopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön seien.
Ehe wir am diese Untersuchung gehen, versetzte er, möchte es wohl nötig sein, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein, sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten, das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden, ohne Charakter gibt es keine Schönheit.
Betroffen über diese Art, sich auszudrücken, versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch sein müsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zu Grunde liege, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen sei. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird leugnen, daß der Knochenbau zum Grunde aller hoch organisierten Gestalt liege, er begründet, er bestimmt die Gestalt, er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hülle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.
Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellet, daß die Schönheit etwas Unbegreifliches, oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem sei. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht, - was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn. (G,Der Sammler..., HA, XII,74f.)
Die beiden Disputanten kommen auf Apoll und Bacchus nicht wieder zurück, sie sprechen über sie als verschiedene Ausdrücke zweier Prinzipien, nämlich einerseits der Schönheit als einem Ideal, einem Allgemeinen, einem von der Welt abgelösten und fiktiven Schein, und der Schönheit als etwas Charakteristischem, als Merkmal des Individuellen, des in der Welt konkret Auffindbaren. Und schon erkennen wir, dass die beiden Anlässe zur Diskussion, der schöne Gipskopf von Apoll und das Marmorhaupt des Bacchus, ein für Goethe typischer Witz übrigens, nicht zufällig gewählt sind und vorausdeuten auf das, was wir dann bei Arthur Schopenhauer, bei Heinrich Heine und Richard Wagner sowie später bei Friedrich Nietzsche finden werden. Goethe gestaltet in Faust. Zweiter Teil. im Dritten Akt. Schattiger Hain, in den Versen 10005 bis 10038 ein sogenanntes Dionysosfest, wo die einen nach dem Äther steigen und die anderen den Hügel umzingeln, wo am Stab die Rebe grünt. Dies auch nur ein Hinweis auf die beiden prinzipiellen Wesenszüge eines Begriffspaars.
Wir schauen kurz noch, wie angekündigt, zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Für ihn entspringt Kunst dem Drang der Menschen, sich selbst gegenständlich zu begegnen. Künstler bringen, seiner Meinung nach, mit der Verdopplung ihrer selbst für sich und andere zur Anschauung und zur Erkenntnis, was in ihnen nach Ausdruck verlangt. Als Produkt des menschlichen Geistes stehe die Kunst höher als jedes Naturprodukt und jede Naturerscheinung, die vom Geist unberührt geblieben sind. Ein Landschaftsbild steht bei Hegel höher als die bloße Landschaft. Ein guter Witz ist besser als ´ne schöne Gegend. Nachahmung der Natur sei einfaches wiederholen des Natürlichen. Wesentlicher Inhalt der Kunst sei die Idee, ihre Form die sinnliche und bildliche Gestaltung. Die Kunst, so Hegel, realisiere im Ideal eine individuelle Anschauung der Wirklichkeit mit der Bestimmung, in sich wesentlich die Idee, also das hineingedachte Göttliche, erscheinen zu lassen. In der Schönheit durch Kunst, repräsentiere sich die gestaltete Geistigkeit, was nichts anderes für Hegel ist als der absolute Geist und damit die Wahrheit selbst. Die künstlerisch für die Anschauung und Empfindung dargestellte göttliche Wahrheit ist für ihn der Kristallisationspunkt der Kunst überhaupt.
Hegel hat in seiner Philosophie der Geschichte, die Nietzsche übrigens ironisch als das Werk bezeichnete, in dem Gott sich selbst (durchsichtig) wurde innerhalb der Hegelischen Hirnschalen(Unzgem. Betr.,I,308), eine interessante Beobachtung niedergelegt, nach der nämlich die neuen Götter der Griechen die Naturmomente und damit das bestimmte Verhältnis zu den Naturmächten... in sich aufbewahren. Helios, so Hegel weiter, kommt dabei die Rolle der Sonne als Naturelement zu. Dieses Licht ist, in der Analogie des Geistigen, zum Selbstbewußtsein umgewandelt, und Apollo ist aus dem Helios hervorgegangen. Der Name ???????( Dycheios) deutet auf den Zusammenhang mit dem Licht... Die Idee des Lichts wird man als die zugrunde liegende Naturmacht aus dieser Gottheit nicht fortbringen können, zumal da sich die anderen Prädikate derselben leicht damit verbinden lassen... Denn Apoll ist der Weissagende und Wissende, das alles hellmachende Licht; ferner der Heilende und Bekräftigende, wie auch der Verderbende, denn er tötet die Männer; er ist der Sühnende und Reinigende, z. B. gegen die Eumeniden, die alten unterirdischen Gottheiten, welche das harte, strenge Recht verfolgen; er selber ist rein, er hat keine Gattin, sondern nur eine Schwester und ist nicht in viele häßliche Geschichten wie Zeus verwickelt; er ist ferner der Wissende und Aussprechende, der Sänger und Führer der Musen, wie die Sonne den harmonischen Reigen der Gestirne anführt. (...) Würde nun gesagt, daß diese Verwandlung des Natürlichen in Geistiges unserem oder späterem griechischen Allegorisieren angehöre, so ist dagegen anzuführen, daß dies Herüberwenden des Natürlichen zum Geistigen gerade der griechische Geist ist... Das Weitere ist, daß die Götter als Individualitäten, nicht als Abstraktionen zu fassen sind... sie sind keine Allegorien, keine abstrakten, mit vielfachen Attributen behängten Wesen... Ebensowenig sind die Götter Symbole, denn das Symbol ist nur ein Zeichen, eine Bedeutung von etwas anderem. Die griechischen Götter drücken an ihnen selbst aus, was sie sind. Die ewige Ruhe und sinnende Klarheit im Kopfe Apollos ist nicht ein Symbol, sondern der Ausdruck, in welchem der Geist erscheint und sich gegenwärtig zeigt. Die Götter sind Subjekte, konkrete Individualitäten; ein allegorisches Wesen hat keine Eigenschaften, sondern ist selbst nur eine Eigenschaft... Eine zweite Quelle des Ursprungs der Besonderheiten ist die Naturreligion, deren Darstellungen ebenso in den griechischen Mythen erhalten als auch wiedergeboren und verkehrt sind. Das Erhalten der anfänglichen Mythen führt auf das berühmte Kapitel der Mysterien.... Wenn man alles Historische, was hier hereinfällt, zusammenstellt, so wird das Resultat notwendig sein, daß die Mysterien nicht ein System von Lehren ausmachten, sondern sinnliche Gebräuche und Darstellungen waren, die nur in Symbolen der allgemeinen Operationen der Natur bestanden, als z.B. von dem Verhältnisse der Erde zu den himmlischen Erscheinungen. Den Vorstellungen der Ceres und Proserpina, dem Bacchus und seinem Zuge lag als Hauptsache das Allgemeine der Natur zugrunde, und das Weitere waren obskure Geschichten und Darstellungen, deren Hauptinteresse die Lebenskraft und ihre Veränderungen sind. Einen analogen Prozeß wie die Natur hat auch der Geist zu bestehen; denn er muß zweimal geboren sein, d.h. sich in sich selbst negieren; und so erinnerten die Darstellungen in den Mysterien, wenn auch nur schwach, an die Natur des Geistes.(Hegel,PhdG,Werke XII,300ff.)
Auch hier begegnen uns wieder die beiden Prinzipien, Apollon und Bacchus - Dionysos diesmal in der historischen Sicht als Bestandteile einer religiösen Weltanschauung, die sich in den Mysterien der Griechen Ausdruck suchte. Auch wieder der idealische, mit dem Licht verbundene Bedeutungskomplex um Apollon und der mit dem Diesseitigen, konkret Menschlichen verbundene des Bacchus, der ja hier nur die lateinische Bezeichnung des griechischen Gottes Dionysos ist. Bei Nietzsche hinwiederum ist diese Synonymität in Bedeutung aufgehoben, denn mit dem Bacchantischen hatte er weder philosophisch noch im richtigen Leben viel im Sinn; doch das Dionysische wurde ihm sozusagen hie wie da, in seiner geistigen Welt wie in seiner Lebenswirklichkeit zur zweiten Natur.
Legen wir uns zunächst einige Verständnishilfen zurecht. Gleich zu Beginn trennen wir uns von der Vorstellung, Nietzsches Begriffe vom Apollinischen und Dionysischen hätten irgendetwas direkt mit den griechischen Göttern zu tun. Das wäre wirklich viel zu schön gewesen. Und zu einfach. Denn dem Thema müssen wir uns notgedrungen nähern durch das Aufkommen des Dichters Heinrich Heine wider die christliche Vereinnahmung der Elementargeister. Denn unser dionysischer Essayist hat von dem Romantiker mehr als nur das sprachliche Rüstzeug übernommen. Viel zu wenig oder gar nicht ist bekannt, dass nicht Nietzsche zuerst gerufen hat, dass Gott tot sei. Dies haben Clemens von Brentano und Heine schon lange vor ihm getan. Viele Haupt- und Nebengedankengänge Nietzsches gehen vor allem auf Heine zurück. Ich möchte nur kurz auf den Umstand der direkten Einflüsse verweisen, denn auch dies wäre, in seinen ideellen Verästelungen gedanklich ausgeformt, auch ein eigenständiges Thema. Heines Bemühen galt dem Umwandlungsprozess, den die alten griechisch-römischen Götter mit dem Christentum erlitten hatten, als das Christentum zur Oberherrschaft in der Welt gelangte; es ging ihm, abstrakter formuliert, um Ideologiekritik: Der Volksglaube schrieb jenen Göttern jetzt eine zwar wirkliche, aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht ganz übereinstimmend mit der Lehre der Kirche. Letztere erklärte die alten Götter keineswegs, wie es die Philosophen getan, für Schimären, für Ausgeburten des Lugs und des Irrtums, sondern sie hielt sie vielmehr für böse Geister, welche, durch den Sieg Christi vom Lichtgipfel ihrer Macht gestürzt, jetzt auf Erden, im Dunkel alter Tempeltrümmer oder Zauberwälder, ihr Wesen trieben und die schwachen Christenmenschen, die sich hierhin verirrt, durch ihre verführerischen Teufelskünste, durch Wollust und Schönheit, besonders durch Tänze und Gesang, zum Abfall verlocken. Heine blickte vor allem auf die Umgestaltung der Naturkulte in Satansdienst und des heidnischen Priestertums in Hexerei, diese Verteuflung der Götter.(Heine,W,VII,57 -- vgl.a. D. Sternberger, H.H.u.d.Abschaffung der Sünde,391ff. 420ff.) Die Reflexion dieser historischen Widersprüchlichkeit springt zunächst von diesem Jahrhundertautor Heine direkte zum Jahrhundertgesamtkünstler Wagner, der Heine weit mehr als nur den Tannhäuser-Stoff zu danken hat. Wir finden uns wieder in der guten Stube Richard Wagners, des Kapellmeisters aus Leipzig, des Dresdner revolutionären Rebellen, des guten Bekannten Heinrich Heines und Georg Herweghs, der Schranze im Umkreis des bayrischen Königs Ludwig Zwo, des Verfassers mehrerer Opern sowie einiger grundlegender theoretischer Werke zur Musikdramaturgie und des Antisemitismus, des lebenslang an einem schieren Endlosmusikdrama über den Ring des Nibelungen Schaffenden, des Mannes also, der die Kunst der Zukunft als eine Art Religion, sicherheitshalber mit sich selbst als Papst, einzuführen gedachte. Friedrich Nietzsche war auf Richard Wagners Weg zu globalem Glanz und interstellarer Gloria die Rolle Eckermanns zugedacht, ja, Wagner war sich nicht zu schade, Nietzsche für seine Adlaten-Dienste als seinen Sohn anzuerkennen(Brief W.,25. 6.72). Im Februar 1870 ist der teuerste Herr Friedrich(Brief W.,4.2.70) oder auch der liebste Unbedenkliche(Brief W., 16.1.70) von Wagner, dem größten Genius und größten Menschen dieser Zeit, durchaus incommensurabel!(N. an Deussen, 25.869), so eingenommen, dass er seine Zukunft von dessen Lippen abliest: Richard Wagner hat mir in der rührendsten Weise zu erkennen gegeben, welche Bestimmung er mir vorgezeichnet sieht.(Brief N. an Rohde,Jan. - Feb.70)
Vorerst jedoch wurde der in seinem zweiten Schweizer Exil lebende Musikdramatiker, der 1866 den Anfeindungen seiner Denunzianten aus München und dem Dunstkreis König Ludwigs Zwo entwichen war, der Kursleiter des in Basel lehrenden Philologen und auf dem Lehrplan stand Schopenhauersche Philosophie (Brief N. an Rhode, 16.7.69). Die Erstbegegnung des 26jährigen Friedrich Nietzsche im Jahre 1870 mit Dionysos, also einem der in unserem Zusammenhang interessierenden mythischen Geister, geschah, als er sich anlässlich eines Besuches im Hause Richard Wagners in Tribschen bei Luzern, dem Heim des in Deutschland per Haftbefehl gesuchten Musikgenies, das Aquarell überm Sofa genauer ansah. Nietzsche musste nahe herantreten, denn seine Augen waren nicht die besten und er sah Bacchus unter den Musen. Dabei waren Wagner, der Freund Rohde und Cosima, Wagners junge Frau, die Tochter Franz Liszts, 33 Jahre alt, Mutter der drei 1865, 1867 und 1869 geborenen Wagner-Kinder. Der Sohn des Röckener Pfarrers und quasi soldatischer Zögling einer züchtig verkniffenen Weiberfront aus Großmutter, Mutter, Tante, Dienstmädchen und Schwester sah der sich ihm da an tapezierter Wand eröffnenden Szene tief bis ins pornographische Mark. Das war es, was er gesucht hatte, das Prinzip der blanken Blasphemie. Dieser Blick auf die dionysische Szene (Brief N an Rohde, 16.7.72,IV,25,94f.) war die Initialzündung für einen geistigen Quantensprung. Der brave Friedrich, der Eckermann in spe, fühlte plötzlich das Zeug zum leibhaftigen Dionysos in sich. Das Bild ist von Bonaventura Genelli und heißt Bacchus unter den Musen. Es zeigt den jugendlichen Gott, der in seiner Linken eine Weinschale schwenkt. Bei Fuß in seinem Rücken liegt ein Panter und zu beiden Seiten umgeben ihn in zwei Gruppen die neun pierischen Schwestern, die Musen, so genannt, weil sie sich in der ruhigen Einsamkeit am Berge Pierius ihren Studien hingaben, vier am Boden vor ihm und zu ihm aufblickend, fünf hinter ihm teils sitzend teils stehend. Bacchus ist nackt, die reizenden Damen züchtig in Tücher drapiert, doch sie himmeln ihn an, jede auf ihre Art. Alle, Bacchus und die Schwestern, sind beisammen, um dem Tanz eines kraftstrotzenden Silens mit einem zartflügligen Amor zuzusehen, die von einem tamburinschlagenden Komus, dem Gott der Zecher und der Schlemmer, in ihrer ekstatischen Enthemmtheit angefeuert werden. Über die Szene, gleichsam wie eine Hängematte, ist ein Tuch gespannt, in der sich ein Zephyr räkelt und lüstern den Tanz verfolgt. Der Zephyr lässt keine Zweideutigkeit zu, wenn der Betrachter des Bildes seine Geschichte kennt, und Nietzsche kannte sie genau. Um die Zuneigung des schönen Knaben Hyakynthos waren Zephyr, der Gott des Westwindes, und Apollon, Gott der Heilung und der Musik, Rivalen. Zephyr zog im Buhlen um die Gunst des Jünglings den Kürzeren. Daraufhin sorgte er dafür, dass die Liaison nicht übertrieben lange dauern konnte. Als Apollon vor Hyakinthos mit seinen Künsten im Diskuswerfen angeben wollte, ließ Zephyr die Westwinde von der Leine und trieb den fliegenden Diskus an die Schläfe dessen, der ihn verschmäht hatte. Aus dem Blut des Hyakinthos ließ der trauernde Apollon eine Blume sprießen, die den Namen des aus Eifersucht Hingemordeten verewigte. Auf Genellis Bild nun schwebt Zephyr über Bacchus, und empfiehlt den Gott der beseelenden Ekstase (und von mir aus auch des Weines) dem Betrachter als Antipoden des Apollon. Um diesen Gegensatz zu verstärken ist Bacchus - Dionysos bei Genelli als Musagetes, als Musenführer in Szene gesetzt, eine Rolle, die auf altgewohnte Weise nur dem Apollon zustand. Diese Auffassung des mythischen Tableaus, das in seiner ursprünglichen, bei den Griechen geltenden Bestimmung der Aufgaben, die Apollon und Dionysos zu erfüllen hatten, völlig korrekt war, lief dem kathederwissenschaftlichen Kanon der universitären Hellenisten Deutschlands, einer damals ganz und gar eigengesetzlich funktionierenden Kaste akribischer Deutler und fiebrig buchstabierender Krittler, deren Epheben deutschlandweit an den Gymnasien den altphilologischen Rohrstock schwangen, absolut gegen den Strich. Apollon hatte als pädagogische Chiffre der helle, klare Jünglingsgott zu sein, dem in mythischer Weihung die reinen Seelen der männlichen Jugend anempfohlen werden konnten. Dionysos daneben war die psychische Mülltonne, all das, was dem reinen deutschen Manne der Zukunft zu unterlassen geboten war, es sei denn, es nützte dem Staat und damit dem Kaiser. Doch das war eine andere, beispielsweise den Krieg betreffende Frage.
Beide Bedeutungskomplexe, der innere, der aus enger Erziehung entpflichtende, und der äußere, dem herrschenden Philologenkanon entgegenstehende, brachten Friedrich Nietzsche in die Lage, angesichts der für ihn sensationellen inhaltlichen Aussage des Genelli-Bildes mit einem Mal so etwas wie eine geistige Mitte in sich zu entdecken. Dionysos, das war der Zauberbegriff, mit dem er seiner in Beschränkung gefesselten Geistesarbeit und seinem protestantisch verkniffenen Körperzwang entfliehen konnte, Dionysos, das war geistige und körperliche Freiheit. Dieser Gottesbegriff wurde ihm zur Kampfchiffre, die ihn für die Zeit seiner essayistischen Tätigkeit bis 1889, als seine Krankheit ausbrach, stetem taktischen Bedeutungswandel unterworfen, als Schild und Schwert diente.
Bisher ist kaum beachtet worden, dass die Herkunft der Begriffe des Dionysischen und des Apolloinischen bei Nietzsche in den Gedankengängen Richard Wagners zu suchen ist. Das Genelli-Aquarell war sozusagen nur das zusammenfassende Bild, in dem Nietzsche den Schlüssel fand, nach dem er Kraft seiner philologischen Erkenntnisse gesucht hatte. Nietzsche schrieb 1872 an Rohde: Du weißt, daß ich bei den ´Musen mit Dionysos in der Mitte´ an das bei Wagner in Tribschen hängende Aquarell Genelli´s gedacht habe.(Brief N an Rohde, 16.7.72,IV,25,94f.) Diese Bemerkung bezieht sich auf eine Schmähschrift des jungen, später angesehenen Gräzisten Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, einem ehemaligen Kommilitonen von Pforta, der Die Geburt der Tragödie gleich nach ihrem Erscheinen gründlich hergenommen und nach herrschendem Lehrstandard heruntergemacht hatte. Kein geringerer als Richard Wagner schrieb im Juni 1872 einen offenen Brief zur Verteidigung Nietzsches, in dem er einerseits die Anschuldigungen des Pamphletisten scharf zurückweist und andererseits formuliert, was er von Nietzsche erwartet, denn diese Forderung schwebt über ihren Gesprächen dieser Zeit, in denen Wagner die Bestimmung für seinen jungen Freund vorgezeichnet sieht(B. an Rohde, Jan. - Feb.70). Zunächst die Verteidigung. Wagner höhnt: ...(Dr. phil.U.W.Möllendorff) behauptet nun aber(...), daß es ganz ernstlich der Zweck der philologischen Wissenschaft sei, Deutschlands Jugend dahin abzurichten, ´daß ihr das klassische Altertum jenes einzig Unvergängliche gewähre, welches die Gunst der Musen verheißt, und in dieser Fülle und Reinheit allein das klassische Altertum geben kann, den Gehalt in ihrem Busen und die Form in ihrem Geist´. Von diesen herrlichen Schlußworten seines Pamphlets noch ganz entzückt, blicke ich mich nun im neuerstandenen deutschen Reiche nach dem unzweifelhaft offen daliegenden Erfolge der segensreichen Wirksamkeit der Pflege dieser philologischen Wissenschaft um, welche, so vollständig ungestört und unnahbar in sich abgeschlossen, nach ihren von nirgendsher bestrittenen Maximen die deutsche Jugend bisher anleiten durfte. Zuerst dünkte es mich nun auffallend, daß alles, was bei uns von der Gunst der Musen als abhängig sich kundgibt, also unsere gesamte Künstler- und Dichterschaft, ganz ohne alle Philologie sich behilft. Jedenfalls scheint der Geist gründlicher Sprachkenntnis überhaupt, wie er doch von der Philologie als Grundlage aller klassischen Studien ausgehen soll, sich nicht auf die Behandlung der deutschen Muttersprache erstreckt zu haben, da man durch den immer üppiger anwachsenden Jargon, welcher aus unseren Zeitungen sich bis in die Bücher unserer Kunst- und Literaturgeschichtsschreiber ausbreitet, bald bei jedem zu schreibendem Worte in die Lage kommen wird, sich erst mühsam besinnen zu müssen, ob dieses Wort einer wirklichen deutschen Sprachbildung angehöre, oder nicht etwa einem Wiskonsiner Börsenblatte entnommen sei.(in: F. Nietzsche, Der Fall Wagner, Schriften u. Aufz.,Insel, S.503f.) Und die schlußfolgernde Forderung an Nietzsche ist: In Wahrheit, mein Freund, Sie sind uns hierüber einige Aufklärung schuldig. Sie treffen in denen, welche ich wir nenne, nämlich auf solche, die von der schwärzesten Sorge für die deutsche Bildung erfüllt sind. Was diese Sorge vermehrt, liegt in dem soderbar günstigen Rufe, in welchem diese Bildung bei den mit ihrem einstigen Blütenansatze spät erst bekannt gewordenen Ausländern steht, und der auf uns wie mit narkotischer Betäubung, bis zu welcher wir uns gegenseitig beräuchern, zurückwirkt... Wie steht es um unsere deutschen Bildungsanstalten? Darnach fragen wir gerade Sie, der Sie so jung berufen..., den Lehrstuhl einzunehmen, und hier sich schnell ein so bedeutendes Vertrauen erwarben, daß Sie es wagen konnten, mit kühner Festigkeit aus einem vitiosen Zusammenhange herauszutreten, um mit schöpferischer Hand auf seine Schäden zu deuten... Was wir von Ihnen erwarten, kann nur die Aufgabe eines ganzen Lebens sein, und zwar des Lebens eines Mannes wie er uns auf das höchste nottut, und als welchen Sie allen denen sich ankündigen, welche aus dem edelsten Quelle des deutschen Geistes...Aufschluß und Weisung darüber verlangen, welcher Art die deutsche Bildung sein müsse, wenn sie der wiedererstandenen Nation zu ihren edelsten Zielen verhelfen soll.(ebd.508f.) Wagner ist äußerst geschickt, er hebt das Problem auf die nationale Ebene - seit dem Französisch-deutschen Krieg ist ein Jahr vergangen, Bismarck hat das Reich neu gegründet und die Franzosen bezahlen als Reparation gerade den Bau des Reichstages in Berlin - und weist Nietzsche die Rolle des Lehrers aller Deutschen zu. Die damit verbundene Bildungsoffensive, daran dürfen wir keinen Augenblick zweifeln, sollte zum Hauptteil damit erfüllt sein, die Lehren Richard Wagners unter das Volk zu bringen und es in den Stand zu setzen, seiner Kunst mit wissender Inbrunst zu huldigen.(vgl. W,I,743,9ff.) Nietzsche war brav und hatte schon im Januar 1872 mit einer fünfteiligen Vortragsreihe Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten begonnen, die bis März abgeschlossen war. Wagner vollzog also mit seiner Forderung im Juni nur nach, was bereits in seinem Sinne vorlag. Und Nietzsche, dessen Vorträge sich in seinem Nachlass fanden, verfasste sie für sonderbare Hörer und Leser: ...er(der Leser) möge gebildet genug sein, um von seiner Bildung recht gering, ja verächtlich zu denken; dann dürfte er wohl am zutraulichsten sich der Führung des Verfassers überlassen, der es nur gerade von dem Nichtswissen und dem Wissen des Nichtswissens aus wagen durfte, so zu ihm zu reden. Nichts anderes will er eben für sich in Anspruch nehmen, als ein stark entzündetes Gefühl für das Spezifische unserer gegenwärtigen deutschen Barbarei, für das, was uns als Barbaren des neunzehnten Jahrhunderts so merkwürdig von den Barbaren anderer Zeiten unterscheidet.(W,I,649f.)
Die Reaktion Wagners auf den Wilamowitz-Angriff gegen Nietzsche und seine Schrift Die Geburt der Tragödie hat seine Wurzeln in den vierziger Jahren, als der damals junge junge Tonsetzer noch revolutionäre Wallungen hatte und neben den Texten Arthur Schopenhauers auch die Werke Ludwig Feuerbachs eifrig studierte. Und von hier kommen wir dann auf kürzestem Wege zu unseren beiden Begriffen zurück. Diesen zugegeben nicht ganz unbeschwerlichen Umweg jedoch müssen wir wagen, weil diesen Zusammenhang zwischen der Feuerbach-Lektüre Wagners und den Begriffen Apollinisch und Dionysisch bei Friedrich Nietzsche bislang noch niemand hergestellt hat. In der Einleitung zu seiner Schrift mit dem bezeichnenden Titel Kunst und Revolution erklärte Wagner mit jenem Höstmaß an Sendungsbewusstsein, das sich später auch auf Nietzsche übertragen sollte: Ich glaube an die Revolution, wie an ihre Notwendigkeit und Unaufhaltsamkeit..., nur fühle ich mich zugleich auch berufen, ihr die Wege der Rettung anzuzeigen. Lag es mir fern, das Neue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte, so fühlte ich mich dagegen begeistert, das Kunstwerk zu zeichnen, welches auf den Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen sollte. Dieses Kunstwerk dem Leben selbst als prophetischen Spiegel seiner Zukunft vorzuhalten, dünkte mich ein allerwichtigster Beitrag zu dem Werke der Abdämmung des Meeres der Revolution in das Bette des ruhig fließenden Stromes der Menschheit.(Wagner,GSuD,III,2ff.) Wagner blieb hier, wir sehen das sofort und auch die Parallelen zum heutigen Tag, ein echter Deutscher. Er wollte eine Revolution mit dem Ziel, das Unterste nach oben zu stülpen, aber alles nicht gar so toll, eher mehr in ruhigen Bahnen, und dann auch eher für die Kunst, mehr so in Richtung Menschheit. Und er reklamierte die führende Rolle nicht für eine Klasse oder eine Schicht oder für eine gesellschaftlich relevante Interessengruppe, sondern für sich selbst: Wo einst die Kunst schwieg, begann die Staatsweisheit und Philosophie: wo jetzt der Staatsweise und Philosoph zu Ende ist, da fängt wieder der Künstler an.(ebd.) Wagner kam auf die Umstände ser Entstehung seiner Schrift und die kritischen Einwände dagegen zu sprechen und zeigt Verständnis dafür, weil er in seiner Erregtheit den Aufzeichnungen mehr einen dichterischen als wissenschaftlich-kritischen Charakter gegeben habe. Er fuhr fort, und es klingt wie eine Einführung zu Nietzsche: Zudem war der Einfluß eines unwählsamen Hereinziehens philosophischer Maximen der Klarheit meines Ausdruckes...nachteilig. Aus der damals mich lebhaft anregenden Lektüre mehrerer Schriften Ludwig Feuerbachs hatte ich verschiedene Bezeichnungen für Begriffe entnommen, welche ich auf künstlerische Vorstellungen anwendete, denen sie nicht immer deutlich entsprechen konnten. Hierin gab ich mich ohne kritische Überlegung der Führung eines geistreichen Schriftstellers hin, der meiner damaligen Stimmung vorzüglich dadurch nahetrat, daß er der Philosophie (in welcher er einzig die verkappte Theologie aufgefunden zu haben glaubte) den Abschied gab und dafür einer Auffassung des menschlichen Wesens sich zuwendete, in welcher ich deutlich den von mir gemeinten künstlerischen Menschen wiederzuerkennen glaubte... In diesem Betreff halte ich es für nötig, hauptsächlich zweier Begriffsbezeichnungen zu erwähnen, deren Mißverständlichkeit mir seitdem auffällig geworden ist. Dies bezieht sich zunächst auf den Begriff von Willkür und Unwillkür, mit welchem... eine große Verwirrung vorgegangen war, da ein adjektivisch gebrauchtes ´unwillkürlich´ zum Substantiv erhoben wurde. Über den hieraus entstandenen Mißbrauch kann sich nur derjenige vollständig aufklären, welcher von Schopenhauer überf die Bedeutung des Willens sich belehren ließ; wem diese unermeßliche Wohltat zuteil ward, weiß dann, daß jenes mißbräuchliche ´Unwillkür´ in Wahrheit ´der Wille´ heißen soll, jenes ´Willkür´ aber den durch die Reflexion beeinflußten und geleiteten, den sogenannten Verstandeswillen bezeichnet. Da dieser letztere mehr auf die Eigenschaften der Erkenntnis, welche irrig und durch den rein individuellen Zweck mißleitet sein kann, sich bezieht, wird ihm als ´Willkür´ die üble Eigenschaft beigemessen, in welcher er auch in diesen vorliegenden Schriften durchgehends verstanden ist; wogegen dem reinen Willen, wie er als Ding an sich im Menschen sich bewußt wird, die wahrhaft produktiven Eigenschaften zugesprochen werden, welche hier dem negativen Begriffe: ´Unwillkür´, wie es scheint infolge einer aus dem populären Sprachgebrauch entsprungenen Verwirrung, zugeteilt sind...
Des weiteren will es mich zu befürchten dünken, daß die infolge der gleichen Veranlassung von mir durchgehends gebrauchte Bezeichnung: Sinnlichkeit, wenn nicht für mich schädliche Mißverständnisse, so doch erschwerende Unklarheit hervorrufen könnte. Da der mit dieser Bezeichnung gegebene Begriff auch in meiner Darstellung nur dadurch einen Sinn erhält, daß er dem Gedanken, oder - wie es die Absicht hierbei deutlicher machen würde - der ´Gedanklichkeit´, entgegengestellt wird, so wäre ein absolutes Mißverständnis allerdings wohl schwierig, indem hier leicht die zwei entgegengesetzten Faktoren der Kunst und der Wissenschaft erkannt werden müssen. Außerdem daß jenes Wort im gemeinen Sprachgebrauche in der üblen Bedeutung des ´Sensualismus´ oder gar der Ergebung an die Sinnenlust verstanden wird, dürfte es aber an und für sich, so gebräuchlich es auch in der Sprache unserer Philosophie geworden ist, in theoretischen Darstellungen von so warmer Aufgeregtheit, wie den meinigen, besser durch eine weniger zweideutige Bezeichnung ersetzt werden. Offenbar handelt es sich hier um die Gegensätze der intuitiven und der abstrakten Erkenntnis und deren Resultate, vor allem aber auch um die subjektiven Befähigungen zu diesen verschiedenen Erkenntnisarten. Die Bezeichnung Anschauungsvermögen würde für die erstere ausreichen, wenn nicht für das spezifisch künstlerische Anschauungsvermögen eine starke Verschärfung nötig dünkte, für welches immerhin: sinnliches Anschauungsvermögen, endlich schlechthin: Sinnlichkeit, sowohl für das Vermögen, wie für das Objekt seiner Tätigkeit und die Kraft, welche beide in Rapport setzt, beibehalten zu müssen unerläßlich dünkte.(ebd.)
Von Feuerbach und von Schopenhauer herkommend, unterscheidet Wagner zwei unmittelbar verbundene Begriffspaare für seine theoretische Grundlegung des künstlerischen Schaffensprozesses, den er als subjektiven menschlichen Prozeß kreativer Tätigkeit, heute würden wir sagen eine Subjekt-Objekt-Beziehung, fasst: einerseits Willkür und Unwillkür, andererseits Sinnlichkeit und Gedanklichkeit. Interessant ist überdies, dass er den künstlerischen Produktionsprozess direkt einbindet in die gesellschaftliche Praxis, was ein für damalige Verhältnisse wirklich revolutionärer Gedanke war, den es dann später in dieser Klarheit nur noch bei Karl Marx und Friedrich Engels gab. Doch das nur am Rande. Genau wie dies, nur so als Hinweis: Wagner war ein leidenschaftlicher Sprachspieler, als Philologe allerdings ein Dilettant, wenngleich ein oft findiger. Sein Begriff der Willkür beispielsweise geht, wie wir gesehen haben, frisch aus der Schopenhauerschen Philosophie durch den kritischen Höllentunnel Feuerbachs direkt über in die Figur der Walküre, und die Gleichstellung Wal- und Willkür, also den nach seiner Meinung durch die Reflexion beeinflussten und geleiteten, den sogenannten Verstandeswillen ist für den musikalischen Sprachspieler nur ein kleiner Gedankenschritt. Wotan nämlich weist die eigensinnige Walküre Brünnhilde in die Schranken, indem er der Beschreibung ihrer Funktion hinsichtlich der Willkür und Unwillkür nichts an Eindeutigkeit erspart: Was bist du, als meines Willens - blind wählende Kür?...Kennst du, Kind, meinen Zorn? - Verzage dein Mut, - wenn je zermalmend - auf dich stürtzte sein Strahl! - In meinem Busen - berg´ ich den Grimm, - der in Grauen und Wust - wirft eine Welt, - die einst zur Lust mir gelacht; - - wehe dem, den er trifft! - Trauer schüf´ ihm sein Trotz!(Wagner, GSuD,VI,Die Walküre,44f.) Grimm und Lust da haben wir wieder zwei Wortpaare, die auf das hinweisen, worauf wir schließlich hinauswollen.
Doch kehren wir zu unserem Hauptgedankengang zurück und verweilen noch einen Augenblick bei Wagner. In seinem Text von 1849 Kunst und Revolution schreibt er: In Wahrheit ist unsere moderne Kunst nur ein Glied in der Kette der Kunstentwickelung des gesamten Europa, und diese nimmt ihren Ausgang von den Griechen. Der griechische Geist... fand, nachdem er... den Schönen und starken freien Menschen auf die Spitze seines religiösen Bewußtseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem eigentlichen Haupt- und Nationalgotte der hellenischen Stämme... Apollon war der Vollstrecker von Zeus´ Willen auf der greichischen Erde, er war das griechische Volk. Nicht den weichlichen Musentänzer, wie ihn uns die spätere, üppigere Kunst der Bildhauerei allein überliefert hat, haben wir uns zur Blütezeit des griechischen Geistes unter Apollon zu denken; sondern mit den Zügen heitern Ernstes, schön, aber stark, kannte ihn der große Tragiker Aischylos... So sah ihn der Athener, wenn alle Triebe seines schönen Leibes, seines rastlosen Geistes ihn zur Wiedergeburt seines eigenen Wesens durch den idealen Ausdruck der Kunst hindrängten; wenn die Stimme, voll und tönend, zum Chorgesang sich erhob, um sogleich des Gottes Taten zu singen und den Tänzern den schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, der in anmutiger und kühner Bewegung jene Taten selbst darstellte; wenn, er auf harmonisch geordneten Säulen das edle Dach wölbte, die weiten Halbkreise des Amphitheaters übereinander reihte und die sinnigen Anordnungen der Schaubühne entwarf. Und so sah ihn, den herrlichen Gott, der von Dionysos begeisterte tragische Dichter, wenn er allen Elementen der üppig aus dem schönsten menschlichen Leben, ohne Geheiß, von selbst und aus innerer Naturnotwendigkeit aufgesproßten Künste das kühne, bindende Wort, die erhabene dichterische Absicht zuwies, die sie alle wie in einen Brennpunkt vereinigte, um das höchste erdenkliche Kunstwerk, das Drama, hervorzubringen.(Wagner, Die Kunst und die Revolution, GSuD,III,9ff.)
Wir halten fest, dass bei Wagner Apollon als das idealisierte Bild erscheint, das der von Dionysos beseelte Künstler schafft. Um das Wortpaar verkürzend schon mit dem Nietzsche-Zungenschlag zu charakterisieren, bleibt, daß das Apollinische bei Wagner das Idealisierte ist, während das Dionysische sich aus dem schönsten menschlichen Leben und aus innerer Naturnotwendigkeit zusammensetzt. Freilich geben wir Wagner zu, dass sich sein Stil recht sehr in der begeisterten Erregtheit verbrämt und wollen es auch dabei belassen, jedoch nicht ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir nunmehr auch die Begriffspaare Unwillkür als Schopenhauers Wille dem Dionysos und Willkür als von Reflexion beeinflußten und geleiteten, den sogenannten Verstandeswillen dem Apollon zuordnen können. Ebenfalls tragen wir hier Wagners Begriffspaar Sinnlichkeit und Gedanklichkeit mit hinzu, also die intuitive, auf das Anschauungsvermögen gerichtete dionysische, und die abstrakte Erkenntnis und ihre Resultate, quasi die apollinische sowie die subjektiven Befähigungen zu diesen Erkenntnisarten. Es geht Wagner nicht um leere Begriffe, sondern um die Grundlegung einer Theorie, deren Aufgabe es ist, das Drama, das Kunstwerk der Zukunft, zu begründen. Als dessen Schöpfer sieht sich Richard Wagner selbst und seine Schrift dient ihm dazu, die Leser an den Gedanken zu gewöhnen, dass er der Gipfel und Ausgangspunkt einer aus der griechischen Glanzkultur herzuleitenden neuen Kunstform sei, des Gesamtkunstwerks, so wie er es selbst verstand. Das Ziel ist klar: Das wahre Streben der Kunst ist daher das allumfassende: jeder vom wahren Kunsttriebe Beseelte will durch die höchste Entwickelung seiner besonderen Fähigkeit nicht die Verherrlichung dieser besonderen Fähigkeit, sondern die Verherrlichung des Menschen in der Kunst überhaupt erreichen. Das höchste gemeinsame Kunstwerk ist das Drama: nach seiner möglichen Fülle kann es nur vorhanden sein, wenn in ihm jede Kunstart in ihrer höchsten Fülle verhanden ist.(Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, GSuD,IV,150)
Ich möchte hier, weil das sonst zu weit führen würde, nur zwei Zitate anfügen, die belegen, wovon Wagner spricht, wenn er sich hinsichtlich der menschlichen Produktivität, in seinem Fall der künstlerischen, auf Feuerbach und Schopenhauer beruft. Ludwig Feuerbach bestätigt den Gegensatz zwischen Geistigkeit und Leiblichkeit und höhnt über die Vorurteile seiner Leser, ganz im Sinne Wagners: Wenn wir also eine Natur, ein dem Lichte der Intelligenz entgegengesetztes Wesen in Gott setzen wollen, können wir uns einen lebendigeren, einen realeren Gegensatz denken, als den Gegensatz von Denken und Lieben, von Geist und Fleisch, von Freiheit und Geschlechtstrieb? Du entsetzest dich über diese Deszendenzen und Konsequenzen? Oh! sie sind die legitimen Sprossen von dem heiligen Ehebündnis zwischen Gott und Natur. Du selbst hast sie gezeugt unter den günstigen Auspizien der Nacht. Ich zeige sie dir jetzt nur im Lichte.(L. Feuerbach,Das Wesen des Christentums, 157f.)
Von Arthur Schopenhauer rücke ich ein Zitat ein, das auch Nietzsche in Geburt der Tragödie benutzt, in der, wie wir gesehen haben, der junge Professor mit einem Bein auf Wagners und mit dem andern auf Schopenhauers Schultern stand. Nietzsche führt ein: Richard Wagner habe, Schopenhauer folgend, feststellt, dass die Musik nach ganz anderen aesthetischen Principien als alle bildenden Künste und überhaupt nicht nach der Kategorie der Schönheit zu bemessen sei: obgleich eine irrige Aesthetik... von jenem in der bildnerischen Welt geltenden Begriff der Schönheit aus sich gewöhnt habe, von der Musik eine ähnliche Wirkung wie von den Werken der bildenden Kunst zu fordern, nämlich die Erregung des Gefallens an schönen Formen. Nach der Erkenntnis jenes ungeheuren Gegensatzes fühlte ich eine starke Nöthigung, mich dem Wesen der griechischen Tragödie und damit der tiefsten Offenbarung des hellenischen Genius zu nahen: denn erst jetzt glaubte ich des Zaubers mächtig zu sein, über die Phraseologie unserer üblichen Aesthetik hinaus, das Urproblem der Tragödie mir leibhaft vor die Seele stellen zu können: wodurch mir ein so befremdlich eigenthümlicher Blick in das Hellenische vergönnt war, dass es mir scheinen musste, als ob unsre so stolz sich gebärdende classisch-hellenische Wissenschaft in der Hauptsache bis jetzt nur an Schattenspielen und Aeusserlichkeiten sich zu weiden gewusst habe. (Nebenbei: Wir erkennen an der großspurigen Gebärde der sprachlichen Präsentation leicht Wagner als den Trainer im Hintergrund, zumal ja auch sein Lied gesungen wird. Zum anderen erfahren wir, warum die Hellenen-Zunft an den Universitäten und anderswo so aufbrausend reagierte. K.B.)
(Nietzsche weiter:) Jenes Urproblem möchten wir vielleicht mit dieser Frage berühren: welche aesthetische Wirkung entsteht, wenn jene an sich getrennten Kunstmächte des Apollinischen und des Dionysischen neben einander in Thätigkeit gerathen? Oder in kürzerer Form: wie verhält sich die Musik zu Bild und Begriff? - Schopenhauer, dem Richard Wagner gerade für diesen Punkt eine nicht zu überbietende Deutlichkeit und Durchsichtigkeit der Darstellung nachrühmt, äussert sich hierüber am ausführlichsten in der folgenden Stelle, die ich hier in ihrer ganzen Länge wiedergeben werde. Welt als Wille und Vorstellung I, p. 309: ´Diesem allen zufolge können wir die erscheinende Welt, oder die Natur, und die Musik als zwei verschiedene Ausdrücke derselben Sache ansehen, welche selbst daher das allein Vermittelnde der Analogie beider ist, dessen Erkenntniss erfordert wird, um jene Analogie einzusehen. Die Musik ist demnach, wenn als Ausdruck der Welt angesehen, eine im höchsten Grad allgemeine Sprache, die sich sogar zur Allgemeinheit der Begriffe ungefähr verhält wie diese zu den einzelnen Dingen. Ihre Allgemeinheit ist aber keineswegs jene leere Allgemeinheit der Abstraction, sondern ganz anderer Art und ist verbunden mit durchgängiger deutlicher Bestimmtheit. Sie gleicht hierin den geometrischen Figuren und den Zahlen, welche als die allgemeinen Formen aller möglichen Objecte der Erfahrung und auf alle a priori anwendbar, doch nicht abstract, sondern anschaulich und durchgängig bestimmt sind. Alle möglichen Bestrebungen, Erregungen und Aeusserungen des Willens, alle jene Vorgänge im Innern des Menschen, welche die Vernunft in den weiten negativen Begriff Gefühl wirft, sind durch die unendlich vielen möglichen Melodien auszudrücken, aber immer in der Allgemeinheit blosser Form, ohne den Stoff, immer nur nach dem Ansich, nicht nach der Erscheinung, gleichsam die innerste Seele derselben, ohne Körper. Aus diesem innigen Verhältniss, welches die Musik zum wahren Wesen aller Dinge hat, ist auch dies zu erklären, dass, wenn zu irgend einer Scene, Handlung, Vorgang, Umgebung, eine passende Musik ertönt, diese uns den geheimsten Sinn derselben aufzuschliessen scheint und als der richtigste und deutlichste Commentar dazu auftritt; imgleichen, dass es Dem, der sich dem Eindruck einer Symphonie ganz hingiebt, ist, als sähe er alle möglichen Vorgänge des Lebens und der Welt an sich vorüberziehen: dennoch kann er, wenn er sich besinnt, keine Aehnlichkeit angeben zwischen jenem Tonspiel und den Dingen, die ihm vorschwebten. Denn die Musik ist, wie gesagt, darin von allen anderen Künsten verschieden, dass sie nicht Abbild der Erscheinung, oder richtiger, der adäquaten Objectivität des Willens, sondern unmittelbar Abbild des Willens selbst ist und also zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller Erscheinung das Ding an sich darstellt. Man könnte demnach die Welt ebensowohl verkörperte Musik, als verkörperten Willen nennen: daraus also ist es erklärlich, warum Musik jedes Gemälde, ja jede Scene des wirklichen Lebens und der Welt, sogleich in erhöhter Bedeutsamkeit hervortreten lässt; freilich um so mehr, je analoger ihre Melodie dem innern Geiste der gegebenen Erscheinung ist. Hierauf beruht es, dass man ein Gedicht als Gesang, oder eine anschauliche Darstellung als Pantomime, oder beides als Oper der Musik unterlegen kann. Solche einzelne Bilder des Menschenlebens, der allgemeinen Sprache der Musik untergelegt, sind nie mit durchgängiger Nothwendigkeit ihr verbunden oder entsprechend; sondern sie stehen zu ihr nur im Verhältniss eines beliebigen Beispiels zu einem allgemeinen Begriff: sie stellen in der Bestimmtheit der Wirklichkeit Dasjenige dar, was die Musik in der Allgemeinheit blosser Form aussagt. Denn die Melodien sind gewissermaassen, gleich den allgemeinen Begriffen, ein Abstractum der Wirklichkeit. Diese nämlich, also die Welt der einzelnen Dinge, liefert das Anschauliche, das Besondere und Individuelle, den einzelnen Fall, sowohl zur Allgemeinheit der Begriffe, als zur Allgemeinheit der Melodien, welche beide Allgemeinheiten einander aber in gewisser Hinsicht entgegengesetzt sind; indem die Begriffe nur die allererst aus der Anschauung abstrahirten Formen, gleichsam die abgezogene äussere Schale der Dinge enthalten, also ganz eigentlich Abstracta sind; die Musik hingegen den innersten aller Gestaltung vorhergängigen Kern, oder das Herz der Dinge giebt. Dies Verhältniss liesse sich recht gut in der Sprache der Scholastiker ausdrücken, indem man sagte: die Begriffe sind die universalia post rem, die Musik aber giebt die universalia ante rem, und die Wirklichkeit die universalia in re. Dass aber überhaupt eine Beziehung zwischen einer Composition und einer anschaulichen Darstellung möglich ist, beruht, wie gesagt, darauf, dass beide nur ganz verschiedene Ausdrücke desselben innern Wesens der Welt sind. Wann nun im einzelnen Fall eine solche Beziehung wirklich vorhanden ist, also der Componist die Willensregungen, welche den Kern einer Begebenheit ausmachen, in der allgemeinen Sprache der Musik auszusprechen gewusst hat: dann ist die Melodie des Liedes, die Musik der Oper ausdrucksvoll. Die vom Componisten aufgefundene Analogie zwischen jenen beiden muss aber aus der unmittelbaren Erkenntniss des Wesens der Welt, seiner Vernunft unbewusst, hervorgegangen und darf nicht, mit bewusster Absichtlichheit, durch Begriffe vermittelte Nachahmung sein: sonst spricht die Musik nicht das innere Wesen, den Willen selbst aus; sondern ahmt nur seine Erscheinung ungenügend nach; wie dies alle eigentlich nachbildende Musik thut.´ - (Hier endet das Schopenhauer-Zitat und Nietzsche schlussfolgert:)
Wir verstehen also, nach der Lehre Schopenhauer´s, die Musik als die Sprache des Willens unmittelbar und fühlen unsere Phantasie angeregt, jene zu uns redende, unsichtbare und doch so lebhaft bewegte Geisterwelt zu gestalten und sie in einem analogen Beispiel uns zu verkörpern. Andrerseits kommt Bild und Begriff, unter der Einwirkung einer wahrhaft entsprechenden Musik, zu einer erhöhten Bedeutsamkeit. Zweierlei Wirkungen pflegt also die dionysische Kunst auf das apollinische Kunstvermögen auszuüben: die Musik reizt zum gleichnissartigen Anschauen der dionysischen Allgemeinheit, die Musik lässt sodann das gleichnissartige Bild in höchster Bedeutsamkeit hervortreten. Aus diesen an sich verständlichen und keiner tieferen Beobachtung unzugänglichen Thatsachen erschliesse ich die Befähigung der Musik, den Mythus d.h. das bedeutsamste Exempel zu gebären und gerade den tragischen Mythus: den Mythus, der von der dionysischen Erkenntniss in Gleichnissen redet. An dem Phänomen des Lyrikers habe ich dargestellt, wie die Musik im Lyriker darnach ringt, in apollinischen Bildern über ihr Wesen sich kund zu geben: denken wir uns jetzt, dass die Musik in ihrer höchsten Steigerung auch zu einer höchsten Verbildlichung zu kommen suchen muss, so müssen wir für möglich halten, dass sie auch den symbolischen Ausdruck für ihre eigentliche dionysische Weisheit zu finden wisse; und wo anders werden wir diesen Ausdruck zu suchen haben, wenn nicht in der Tragödie und überhaupt im Begriff des Tragischen?(Nietzsche, Geburt der Tragödie, W,I,104-108 - Schopenhauerzitat in Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung,W,I,346ff.) Mit dieser Erklärung sind wir vorläufig an jenem Punkt angelangt, der uns zeigt, dass Nietzsche mit der theoretischen Begründung des Apollinischen und des Dionysischen zu diesem Zeitpunkt, also etwa um 1872, das frühere Streben Richard Wagners nach dem Kunstwerk der Zukunft, dem Gesamtkunstwerk sekundiert und versucht, dieses als Subjekt-Objekt-Relation festgemacht gedankliche Konstrukt auf erkenntnistheoretischer Ebene kritisch zu verallgemeinern.
Von hier aus nun wollen wir aus der Vogelperspektive das gesamte Gebiet der uns interessierenden mythologischen Landschaft mit einem flüchtigen Blick würdigen, um wenigstens eine ungefähre Vorstellung von dem zu bekommen, worauf wir uns tatsächlich eingelassen haben. Wir wollen uns nicht in einen tiefenmythologischen Rausch steigern, doch ein wenig Kundigkeit kann nie schaden; und wenn wir schon einmal hier sind, schauen wir uns die Mumien einfach einmal an.
...
|
|
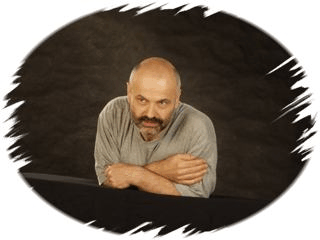 |
|