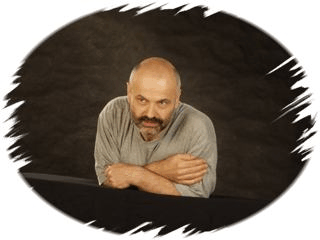|
Anmerkungen zu Prinz Joseph
|
...
Prinz Joseph wurde am 5. Oktober 1702 im Schloß von Erbach (Odenwald) geboren, einer Stadt, etwa so groß wie
Hildburghausen, die das Stadtrecht 1321, also drei Jahre früher als seine Namensstadt, erhielt. Er war das fünfte und
jüngste Kind von Henriette Sophie von Waldeck (1662-1702) und Ernst von Sachsen-Hildburghausen (1655-1715). Die
vierzigjährige Mutter starb zehn Tage nach seiner Geburt im Erbacher Schloss. Die herzogliche Familie war von
Hildburghausen nach Erbach gekommen, um den ältesten Sohn, den Erbprinzen Ernst Friedrich I. von Sachsen-Hildburghausen
(1681-1724), mit Sophie Albertine von Erbach (1683-1742), nach der das Gut Sopienthal benannt wurde und die später über 15
Jahre ihren Witwensitz im Eisfelder Schloss haben sollte, unter die Haube zu bringen. Als jüngster Sohn eines nicht sehr
betuchten Adelsgeschlechts, als Halbwaise noch dazu, als Nachkömmling 21 Jahre hinter dem Erstgeborenen stehend - da
blieben drei Möglichkeiten. Entweder der Spross würde Geistlicher oder Militär oder er ging unter. Zunächst der erste
Versuch. Ein Theologe mit dem sprechenden Namen Friedrich Pantzerbieter nahm den fünfjährigen Prinzen auf Schloss Erbach in
die Hofmeister-Mangel. Erkennbare persönliche Entwicklungen aus dieser Schicksalsgemeinschaft sind lediglich bei dem
Theologen auszumachen. Er wurde später Superintendent in Eisleben, noch später in Darmstadt. Der zweite Versuch. Am 3.
November 1709 behängte die Verwandtschaft den siebenjährigen Joseph mit dem kurpfälzischen Haus-Ritterorden vom Heiligen
Hubertus, eine dekorative Medaille, die die Familienzugehörigkeit derer von Erbach und Waldeck dokumentierte. Es war eine
gewöhnliche Geste, pädagogisch wertvoll immerhin. Ansonsten so hilfreich wie Christbaumschmuck. Prinz Joseph trug den Orden
später, nachdem er konvertiert war, niemals. Der - wenn wir den Bildern und Beschreibungen glauben dürfen - hochgewachsene
und kräftig ausgebildete Kerl, dem als Mann eine unwiderstehliche Anziehung auf bestimmte Frauen nachzuweisen war, starb im
85. Lebensjahr, nachdem er sich standesgemäß nach einem anstrengend hingebrachten halben Jahr eine gewaltige Erkältung
zugezogen hatte, die ihn aus dem Leben stieß. Als Ritter vom goldenen Vlies war Prinz Joseph Mitglied eines hochangesehenen
Fürstenordens, den der Kaiser höchstselbst noch in seiner Zeitgenossenschaft vor allem an Veteranen der sogenannten
Türkenkriege verlieh. In jüngeren Jahren durfte Prinz Joseph an der Militärgrenze auf dem Balkan, wo sich die christlichen
Europäer und die muslimischen Osmanen seit 1521 kriegerisch gegenüberstanden, als untergeordneter Truppenführer seine
hervorstechendsten militärischen Erfolge erringen. Das Erscheinungsbild des Ordens vom Goldenen Vlies war, der
ideologischen Bedeutung der Systemauseinandersetzung entsprechend, pompös. Ein goldenes Widderfell, das an einer
goldbordierten und meergrün emaillierten, aus Feuerstahl- und flammenden Feuerstein-Formen gebildeten Kette, gewöhnlich
aber an einem ponceauroten Bande getragen wurde, hinzu kam ein hochroter samtener Talar, darüber ein purpurner Mantel
mit Saum von weißem Atlas und eine purpurne, goldgestickte Samtmütze. Dieser Aufzug passte ganz und gar zu unserem
Geburtstagskind. Deshalb dürfen wir das Ordensmotto Ich habe es unternommen als Motto über dem Leben unseres Prinzen
Joseph anbringen. Denn in all seiner Verschrobenheit und großmännisch wilden Denkungsart hat er für die Stadt
Hildburghausen manch Gutes getan - und nun wollen wir in angemessener Kürze die mäandernden Gänge seines Lebens verfolgen
und sehen, wie es dazu kam.
Im Hause seiner Tante Albertine Elisabeth von Waldeck, der Schwester seiner Mutter, die ihrerseits mit dem Grafen Philipp
Ludwig von Erbach-Erbach (?-1720) auf Burg Erbach im Odenwald verheiratet war, wuchs Joseph auf. Als sein Vater 1715 in
Hildburghausen starb war er dreizehn Jahre alt. Sein Bruder Ernst Friedrich I. hatte in Hildburghausen eigene Probleme zu
bewältigen und so blieb der Heranwachsende bei der Verwandtschaft in Erbach, wo ihn ein alter Soldat, der überall in Europa
schon gedient hatte, gezielt auf die militärische Laufbahn vorbereitete und ihn auch nach Wien in die Nähe des kaiserlichen
Hofes brachte. Hier fiel er dem Reichsgeneral Friedrich Heinrich Graf von Seckendorf (1673-1763) in die Hände, dessen
Familie selbst aus dem Hildburghausener Königsberg stammte und dem Ritterkreis Franken mit Besitzungen bis in den Odenwald
hinein angehörte. Dieser später berühmte österreichische Militär und Diplomat richtete den jungen Hildburghausener Prinzen
vollends zum Militärhengst ab. Mit fünfzehn Jahren trat Joseph dem Seckendorffschen Infanterieregiment bei und war mit
achtzehn bereits Kompaniechef. Weil er sich in kaiserlichen und königlichen Hofsachen, die ja bekanntlich eine eigene
Wissenschaft sind, noch nicht sicher war, vertraute sich der jugendliche Prinz Joseph in Wien dem ebenfalls aus dem
fränkischen Adel kommenden Johann Christoph Freiherr von Bartenstein (1690-1767) an, der aus Karrieregründen 1715 zum
Katholizismus übergetreten war und im Dunstkreis Maria Theresias (1717-1780) schnell Einfluss gewann, bis ihn 1753 der
clevere Wenzel Anton Graf von Kaunitz (1711-1794) für die Außenpolitik kaltstellte, er aber als Direktor des Geheimen
Hausarchivs nach innen seinen Einfluss behielt. Wir dürfen annehmen, dass Prinz Joseph seine Bekanntschaften sorgsam
pflegte und sie ihm für die Zeit seines Lebens zum Kapital gerieten, nicht nur im Hinblick auf seine überaus guten
Beziehungen zur Kaiserin. Indes stagnierte zunächst die ganze Sache. War der halbwüchsige Joseph zum Titel eines
Kompaniechefs gekommen wie ein Kind zu Masern, so war er zwölf Jahre und etliche Feldeinsätze in Sizilien, Italien und auf
dem Balkan später immer noch nichts anderes als Kompaniechef. Inzwischen hatte er im zwanzigsten Lebensjahr auf die
Herrschaftsnachfolge in Hildburghausen verzichtet, was ihm von Wien aus nicht sonderlich schwer gefallen sein dürfte. Sein
Vorteil war, dass er nichts anderes gelernt hatte als das, was adlige Soldaten eben können. Reiten, mit dem Säbel rasseln,
Uniformen anziehen, totschießen und sich totschießen lassen, den Frauen gewisse Dienste erweisen, Saufen, Hunde züchten und
was dieser Dinge mehr waren. In diesen Disziplinen allerdings schien der Kompaniechef sich einen gewissen Ruf erworben zu
haben. Der Kaiser Karl VI. (1685-1740), der Vater Maria Theresias persönlich, stand als Taufpate an der Seite des
fünfundzwanzigjährigen Joseph von Sachsen-Hildburghausen, als dieser sich in der neapolitanischen Kathedrale San Lorenzo
Maggiore am Grabmal der Katharina von Österreich zum Katholiken umtaufen ließ und auch zum äußerlichen Zeichen seiner
Konversion hinfort all seinen Namen den der Jungfrau Maria noch hinzufügte. Das war die Zeit, als der Kaiser mit
weitreichenden kontinentalen Plänen umging und alle möglichen Bündnispartner gegen Frankreich und England gebrauchen
konnte, auch den preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688-1740), der noch zwischen den Fronten lavierte, um
einen europäischen Krieg zu verhindern. Der Österreicher wollte unbedingt die Pragmatische Sanktion durchsetzen und
zunächst den Pariser Präliminarvertrag unter Dach und Fach bringen. Des Kaisers Geste väterlicher Fürsorge dem Sachsen-
Hildburghausener gegenüber mag ihre Wirkung über Dresden nach Berlin nicht verfehlt haben. Gleichwohl, soviel ist sicher,
es war nunmehr abzusehen, dass die prinzliche Karriere nicht weiter in schlammverschmierten Soldatenstiefeln auf der Stelle
treten würde. Zufall oder nicht, jedenfalls rückte Prinz Joseph, der zwar zum stattlichen Offizier und körperlich
eindrucksvollen Mannsbild herangewachsen war, doch im Finanziellen eher mager daherkam, dem ältlichen Prinzen Eugen
(1663-1736), dem Türkenschlächter, dem Machiavelli von Wien, vor die Augen und der schaute sich den Raufbold nun genauer
an, was zunächst zu Beförderungen führte. Joseph avancierte zum Oberst im Palffyschen Infanterie-Regiment, das seinen Namen
dem Feldmarschall Karl von Palffy () verdankte, der einst, im Jahre 1694, dem jungen Prinzen Eugen half, zum
Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Italien ernannt zu werden. Der Palffyschen Truppe ging ein robuster Ruf
voraus. Es handelte sich um einen ziemlich wilden Haufen, dem Prinz Joseph nunmehr als Kommandeur voranritt und in dem er
sich an der Militärgrenze richtig austoben konnte. Regimentskommandeur und Inhaber - also auch Ausstatter - dieser
kaiserlichen Eingreiftruppe, blieb er auf Allerhöchste Gestellung hin bis zu seinem Tode. Die Palffysche Truppenfahne wehte
überall dort, wo es brannte, meist in Italien und auf dem Balkan. So konnte es nicht ausbleiben, dass die kaiserlichen
Majestäten mehr zu wissen verlangten von den tollkühnen Kerlen, die so gut draufhauen konnten und natürlich von ihrem
Anführer. Es gab um diese Zeit so eine für das Leben des Prinzen Joseph überhaupt charakteristische Liebesaffäre. Ihm war
eine schöne junge italienische Witwe aus dem neapolitanischen Della-Carra-Clan aufgefallen, die zu all ihren irdischen und
himmlischen Vorzügen auch noch ungeahnt üppige finanzielle Polsterungen zählen durfte. An Liebesschwüren scheint es nicht
gemangelt zu haben. Am Vorabend der Trauung jedoch verschwand die Braut spurlos. Sie war von ihrer geldgierigen
Verwandtschaft, die eigene Pläne mit dem Erbe der Schönen anstellte, kurzerhand entführt worden und unser gedemütigter
Bräutigam sah sie nie wieder. So war das in seinem Leben. Wenn es zum Treffen kam, lag etwas quer. Der entscheidende Moment
passierte und genau dann ging immer irgendetwas schief. In seinem 32. Lebensjahr wendete sich viel. Der Wiener Hof hatte
gerade im Zuge des Polnischen Thronfolgekrieges wieder einmal die Zeichen der Zeit verschlafen und die politische Lage nach
schreckhaftem Erwachen überinterpretiert. Der mit einundsiebzig Jahren greise Prinz Eugen, Chef des Auswärtigen, hatte
immer wieder beschwichtigend auf den Kaiser gewirkt, er wolle sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der sardische
König so dumm sein und sich auf die Seite Frankreichs schlagen könnte. Da es nun aber einmal so gekommen war, schickte der
Kaiser eine Armee von Pilzen an den Rhein und hatte mehr Glück als Verstand, denn die geschäftstüchtigen Holländer waren
vertraglich mit Frankreich zur Neutralität gezwungen und sahen auch keinen großen Sinn darin, sich in polnische
Angelegenheiten zu verwickeln. In Italien allerdings drohte die spanisch-französisch-sardische Koalition Österreich den
Garaus zu machen. Prinz Eugen, im Kopf schon etwas klapprig, zog angesichts dieser Gefahr aus Italien zunächst zwei
Infanterieregimenter und ein Husarenregiment aus Oberitalien zurück. Nachdem er seinen Irrtum erkannt hatte, lehnte er
wohlweislich den Oberbefehl an der Südfront ab mit der Begründung, er könne schlecht als Savoyer gegen seine Landsleute
kämpfen - Rücksichten, die ihm im Übrigen früher nie etwas ausgemacht hatten - und ging lieber an den schönen Rhein, wo die
Lage übersichtlicher war. Er wusste, so senil war er nun auch wieder nicht, dass es in Oberitalien heiß hergehen würde und
auf seine alten Tage wollte er sich den in türkischem Pulverdampf und schweren Balkanstaub gegerbten Pelz nicht vollends
verbrennen. So übernahm am Oglio der österreichische Feldmarschall Claudius Florimund Mercy (1666-1734) den Oberbefehl, ein
Haudegen, gerade mal drei Jahre jünger als Prinz Eugen, dafür aber völlig taub und nahezu blind. Mercy zog bei Parma 50.000
Mann zusammen, trat den Franzosen und den Sarden tapfer entgegen und starb im Schlachtgetümmel den Soldatentod. Nachdem
6.000 Österreicher gefallen auf dem Felde blieben, zog sich die habsburgische Streitmacht zurück. Nun übernahm Lothar
Joseph von Königsegg () die Führung, blies zum Angriff und musste sich seinerseits zurückziehen. Das Königreich Neapel fiel
in die Hände der Spanier, ebenso Sizilien. Und am Mittelrhein zauderte und taktierte Prinz Eugen so lange, bis die
militärischen Ergebnisse einer glatten Niederlage gleichkamen. In Oberitalien kämpfte auch Prinz Joseph an der Spitze
seiner Truppe und holte sich vor Parma einen Oberschenkeldurchschuss und einen Treffer im Gesicht. Sein Degen, so die
gerüchteweisen Berichte, soll ihn vor schwereren Verletzungen bewahrt haben, etliche Projektile seien von ihm abgeprallt.
In den Quellen werden mancherlei heldische Taten ausgewalzt, von gefangenen Generälen und erbeuteten Kriegskassen ist die
Rede und von tollkühnen Kommandounternehmen, bekleistert mit seltsamen Anektoden. Alle laufen auf die übliche Rambo-
Geschichte hinaus: Der Einzelheld kämpft tapfer und siegreich, die Armee im Großen und Ganzen jedoch geht unter, beileibe
jedoch nicht vor dem Feind, sondern vor der Witterung. Beliebt sind in dieser Hinsicht immer ziemlich kalte Winter, die den
Nachschub blockierten, oder endlose Regenfälle, so dass die Kanonen im Schlamm der Zufahrtsstraßen zurückgelassen werden
mussten. Unser Held wurde 1735 zum Feldmarschallleutnant befördert. Da waren alle aber schon auf dem Rückzug in Tirol.
Nachdem in Wien der Präliminarfriede ausgehandelt worden war, trafen sich in Verona die militärischen Befehlshaber der
oberitalienischen Kontrahenten. Prinz Joseph war dabei und soll die Verhandlungen für seinen Kaiser selbstbewusst
beeinflusst haben. Das sprach sich herum und dem noch jungen Hildburghausener Militär gelang es, sich als Haudegen ins
öffentliche Gespräch zu bringen. Im Genealogisch-Historischen Archiv von 1737 (32. Teil), in dem sächsischen Erlauchten die
Heiligenscheine aufgesetzt wurden, sind Verdienste und Legenden zu einem biographischen Boulevard-Artikel zusammengerührt,
der auch heute einem der bunten Blätter entnommen sein könnte: Der General-Feldzeugmeister: Joseph Friedrich. Printz
von Sachsen-Hildburghausen. In diesem Printzen regt sich das Blut der alten Sächsischen Helden auf eine sehr ausnehmende
Weise. Er ist vor vier Jahren erst General-Feld-Wachtmeister worden, und gleichwohl gibt er ietzo schon einen
commandirenden Feld-Herrn ab, jedoch wenn man erweget, was er an dem tapffern und klugen Grafen von Seckendorff, der ihn
zuerst mit zu Felde genommen, und anfangs beständig unter seiner Aufsicht gehabt, vor einen vollkommenen Lehrmeister in der
Kriegs-Wissenschaft und Helden-Arbeit gehabt, der wird sich so sehr darüber nicht verwundern, zumal wenn man diesen
vortrefflichen Printzen nach seinen persönlichen Eigenschafften zu kennen das Glücke hat. Er ist hertzhafft, kühne, listig,
und von einer scharfen Penetration (Durchsetzungsfähigkeit,K.B.). Die Anschläge der Feinde weiß er glücklich zu entdecken,
scheuet keine Gefahr, ist geschickt, allerhand erlaubte Kriegs-List zu erfinden, auch behertzt, solche auszuführen. Er
giebt daher einen guten Partheygänger ab, und hat in dem letztern Kriege in Italien mehr als einmal die Feinde mit seinen
listigen Erfindungen berücket. Die kühne Expedition wider den Marschall von Broglio an der Secchia würde der Graf von
Königseck schwerlich unternommen haben, wenn nicht der Printz von Hildburghausen den Tag vorher als ein verkleideter
Tobacks- und Brantewein-Händler das Frantzösische Lager bei Quistello rekognosciret hätte; und der Marquis von Mailebois
würde im Oktober Anno 1734 von Mirandola nicht so eilig wieder abgezogen seyn, wenn nicht eben dieser verschlagene Printz
ihn durch seine listig ersonnenen höltzernen Canonen erschrekt hätte. Er schlug auch Anno 1735 die Spanier von ihren
Postirungen an der Etsch und Secchia mit großen Verlusten zurücke. Er ist noch jung, und allererst 35 Jahre alt; daher zu
hoffen steht, daß, wenn er mit seinen Kriegs-Thaten so glücklich fortfähret, er mit der Zeit ein anderer Printz Eugenius
werden dürffte. Die Frantzosen haben wenigstens darauf praeludiert, wenn sie ihn in Italien insgemein nur Le grand Saxe
genennet. Darauf lief es also hinaus: ein Sachse sollte auch so etwas zuwege bringen wie der Printz
Eugenius. Ein gewiefter Sachse wäre angesichts dieses heraufkommenden eigenwilligen Preußenkönigs, der sich der
Protektion von Prinz Eugen zu Nutz und Frommen Österreichs sicher sein durfte, ein gewisses Gegengewicht, sowohl nach innen
als politischer Pfand als auch nach außen zur Verbreitung eines zeitgemäßen Images. Prinz Joseph wusste von den
unzuverlässigen Preußen ein Lied zu singen. Er hatte vor Jahr und Tag aus Siebenbürgen vier Lange Kerls nach Berlin
expedieren lassen. Als er den preußischen König - den Soldatenkönig und Vater Friedrichs II. immerhin - an sein Versprechen
auf den Erwerb eines Amtes und die Auszahlung von 600 Gulden erinnerte, ward ihm keine Antwort zuteil. Das Amt konnte er in
den Wind schreiben, die 600 Gulden bekam er nicht. Und was aus den vier mühsam zusammengefangenen langen
Grenadieren in Preußen geworden war, wusste der Teufel. 1736 starb Prinz Eugen und Prinz Joseph durfte bei der
Beerdigung neben anderen Generälen, die unter dem Kommando des Verstorbenen im Felde gestanden hatten, das Bahrtuch
mittragen. Zu dieser Zeit war aus dem Gouverneur, also dem Orstkommandanten, von Komorn an der Donau, dem heutigen Komarno,
Durchfahrtstation auf halbem Weg der Norduferstraße von Bratislava nach Budapest, der Oberbefehlshaber der florentinischen
Truppen im Großherzogtum Toskana geworden. Und gleich nach dem Begräbnis des Türkenschlächters Eugen erhielt er die
Beförderung zum Reichsfeldzeugmeister. Das hieß, in dieser Stellung fand er direkt beim kaiserlichen Rat Gehör und suchte
dank dieses Umstands reformerische Projekte durchzusetzen. Des Prinzen Joseph Ruf als Haudrauf nutzend, ließ es sich der
kaiserliche Rat denn auch angelegen sein, ihm 1737 ein Sonderkommando an der kroatischen Militärgrenze auf dem Balkan
anzuvertrauen. Im Vorjahr schon war im österreichisch-türkischen Grenzgebiet in Kroatien eine gewisse Unruhe zu spüren
gewesen. Unzufriedenheit schien hervorzubrechen. Die Orstvorsteher kündigten an, wenn sich nichts an ihrer sozialen Lage
verbessere, begäben sie sich allesamt unter türkischen Schutz. Der Kaiser nun gab dem Prinzen Joseph auf, den
vermeintlichen Unruhestiftern einige neue Gesetze nahezubringen, ihnen auch zu erläutern, was es hieße, gegen
österreichisches Kriegsrecht zu verstoßen und was der Kaiser in eigener Person unter Gehorsam und Ordnung verstünde. Den
Auftrag bearbeitete der Prinz auf seine Weise. Er befahl den zusammengetriebenen Ortsvorstehern nach einer gehörigen
Standpauke, zum Einverständnis dessen, was er ihnen als kaiserlichen Willen kundgetan, ihn selbst unter lauthals
herausgeröhrten Freuderufen dreimal in die Luft zu werfen. Würde solches getan, sei nachher ein gewaltiges Besäufnis die
Besiegelung dessen, was gewissermaßen vereinbart worden war. Die Vorstände warfen den Prinzen in die Luft, bekundeten
angemessen ihre Zuwendung dabei und schritten, nachdem in allen Kirchen der obligatorische griechisch-orthodoxe
Gottesdienst abgehalten worden war, unter dem Böllerdonner der versammelten österreichischen Kanonen zum Besäufnis, das
sich hinzog und nachhaltige Auswirkungen hatte. Von Unruhen war aus dieser kroatischen Grenzgegend fortan nie wieder zu
hören. Ein solcher Erfolg war wichtig. Denn noch im gleichen Jahr 1737 begann ein erneuter Feldzug gegen die Türken in
Bosnien, bei dem Prinz Joseph das 17.000 Mann starke slavonische Korps befehligte und die Truppe bis vor die Festung Banja
Luka, tief im osmanischen Operationsgebiet, führte. Die Eroberung der Zitadelle gelang nicht, zumal der Pascha von Travnik
mit einer Übermacht heraneilte, um die Festung zu entsetzen. Der Feldzug schlug fehl. Doch auch hier zeigte sich wieder das
gleiche im Bild: Der tapfere Prinz und die sich zurückziehende Armee. Auch hier wieder der Vergleich mit dem Prinzen Eugen
von Savoyen. Als äußerliches Zeichen des Erfolges erhielt Prinz Joseph vier Monate nach seinem Auszug, die Türken das
Fürchten zu lehren, die Ernennung zm Ritter des Goldenen Vlieses. Das war in seinem 35. Lebensjahr und die Bestätigung
einer sehr hohen kaiserlichen Wertschätzung. Denn dieser Orden galt als das edelste Schulterklopfen, das der Kaiser zu
vergeben sich die Ehre gab - natürlich nur an erlauchte Häupter, die Herren von und zu blieben da gemeinhin unter sich.
Seit dem Tod des bayerischen Herzogs Ferdinand Maria im Jahre 1738 war die Stelle des Generalfeldzeugmeisters vakant. Nun,
nachdem der tote savoyische Löwe Prinz Eugen seinen Sonnenglanz auf den Prinzen Joseph warf, fanden es ihre kaiserliche
Munifizenz 1739 für angemessen, sich in ihm eines neuen Reichsgenerals zu versichern. Prinz Joseph bewarb sich,
höchstwahrscheinlich noch im Hochgefühl des Prinz-Eugen-Fiebers seiner Gattin und in Überschätzung seiner tatsächlichen
Fähigkeiten. Möglich auch, dass der Gedanke darein spielte, er müsse seinem geliebten Kaiser Karl VI. (1685-1740) gleich
dem teuren verblichenen Onkel einen weithin sichtbaren Treuebeweis liefern. Am 20. April 1739 wurde er, was er zu werden
vorgab, Reichsgeneralfeldzeugmeister. Als der Kaiser ein gutes Jahr später starb, folgte ihm seine Tochter auf der
Grundlage der Pragmatischen Sanktion auf dem Thron. Gutes Wetter für Prinz Joseph. Maria und Joseph mochten sich. Sie war
eher praktisch veranlagt und direkt, er eher grob und geradezu - und so protegierte sie ihn auf Schritt und Tritt. Nicht
auszuschließen, dass sie auch seine reichhaltige Ehe anbahnte. Keiner denke an Zufall, wenn er hört, dass der erste Sohn
Maria Theresias Joseph hieß und als Joseph II. (1741-1790) im Jahre 1765 den Kaiserthron bestieg. Ihr sei während der
Schwangerschaft hin und wieder der Heilige Joseph erschienen, dem sie sich anempfohlen habe. Doch wie, könnten wir fragen,
sah der Heilige aus in den Träumen der Kaiserin? War er groß gewachsen wie ein gewisser Reichgeneralfeldzeugmeister? Hatte
er eine starke Nase und einen stiernackigen Habitus? Eine Antwort gibt uns die Liste der Taufpaten für den Habsburger
Erben: Der Kardinal Sigismund Graf Kollonitsch (1677-1751) vertrat den Papst Benedikt XIV. (1675-1758). Weder der Kardinal
noch der Papst konnten einem Joseph ähnlich sehen. Joseph Maria Friedrich Wilhelm Hollandinus Prinz von Sachsen-
Hildburghausen trat als Stellvertreter des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen August III. ans Taufbecken. Die
sächsische Majestät weilte in Dresden und Maria Theresia hatte ihn, nach allem was wir wissen, noch nie gesehen. Auch er
kam für kaiserliche Joseph-Träume nicht in Betracht. Der Ruf eines tapferen Kriegers wehte Prinz Joseph voran und so wurde
er von den wählenden Adelshäuptern, die die Reichsgeneräle beriefen, mehrheitlich akzeptiert, sogar der preußische
Soldatenkönig stimmte für ihn - vielleicht, weil er dabei an seine Schulden von den vier langen Kerls her gedacht haben
mag. Die Aufgabe im militärischen Reichsamt war aber sowohl undankbar als auch aufreibend. So soll Prinz Joseph schon nach
zwei Jahren in seiner feinen Art resigniert haben, lieber wolle er ein Rudel Hunde zum Grasen führen als weiter den
Reichstrottel machen. Er quittierte den Dienst und suchte fluchtartig seinen gewohnten Lebensrhythmus im österreichischen
Heer. Auch hier beobachten wir das Treffen und den Rückzieher kurz darauf. Die sogenannte Militärgrenze brachte dem Prinzen
Joseph diejenigen Meriten ein, die seinen Ruf am Hofe festigten und sein Image bis ans Lebensende bestimmten. Hier konnte
er als Außenseiter die Möglichkeiten, die ihm persönlich zur Verfügung standen, ganz und gar ausspielen. Die Militärgrenze
war ein Ausnahmeraum, ein Gebiet, auf dem die Gesetze des Staates, ja mehr noch der Zivilisation für nichts galten. Hier
schuf sich die Wehrorganisation ihren eigenen Staat und Prinz Joseph war in seinem Element. An der Grenze des
habsburgischen Territoriums zu dem der Osmanen auf dem Balkan verlief sie zur Zeit unseres Helden ungefähr auf der West-
Ost-Linie von Istrien über Bihac, die Save entlang bis zum Eisernen Tor bei Orsova, an den Südkarpaten hin bis über
Kronstadt hinaus und dann nach Norden in die Bukowina hinein bis auf die Höhe von Bistritz, runde 1.750 Kilometer lang. Das
Gesamtgebilde war unterteilt in die kroatische, die slavonische, die Banater und die siebenbürgische Militärgrenze. Prinz
Joseph war in der kroatischen Militärgrenze zu Hause, die von Jasenica an der Adria und Knin, an der Una entlang, an Bihac
vorbei nordwärts bis an die Drau bei Varasdin führte und sich dort der slavonischen Militärgrenze anschloss. In diesem oft
hundert und mehr Kilometer breiten Grenzstreifen herrschte ein eigenes Organisations- und Verfassungsstatut. Die dort mit
ihren Familien lebenden Bauernsoldaten waren zu permanentem Waffendienst in ihren jeweiligen Grenzregimentern verpflichtet
und blieben für ihren Dienst abgaben- und steuerfrei. Die Höfe, auf denen sie naturgemäß in ständiger Gefahr, von den
türkischen Truppen angegriffen zu werden, lebten, hatten den Ausnahmestatus eines Militärgrenzlehens. Prinz Joseph, der
sich in Kroatien wohl fühlte und seine Wehrbauern kannte wie keiner sonst und auch ihre Sprache beherrschte, hatte während
seines Wirkens im Bereich der Militärgrenze von 1744 bis 1749 die Idee, die familiären Verbünde organisatorisch den
Linienregimentern der k.u.k. Armee gleichzustellen und dem Vorstand Kommandeurvollmacht zu geben. Die einzelnen
Kommandogliederungen konnten auf solche Weise militärisch selbstständig handeln und den osmanischen Truppen auf ihrem
eigenen Operationsgebiet einen permanenten aufwändigen und zermürbenden Kleinkrieg liefern. Diese taktische Neuerung sollte
für die Zukunft - ja im Wesentlichen bis heute - für diesen geographischen Raum von ausschlaggebender Bedeutung sein. Denn
in gewisser Weise erfand und zementierte Prinz Joseph auf dem Balkan damit die Methode des Partisanen- oder Guerilla-
Kampfes. Diese Art des Krieges wurde im Übrigen dann erst sehr viel später, nämlich im spanischen Unabhängigkeitskrieg
gegen Napoleon 1808, als Erscheinung des Kleinkrieges, was ja nichts anderes als der spanische Begriff Guerilla bedeutet,
mit diesem Namen belegt und weltpolitisch als Form des Verteidigungs- und Befreiungskrieges wahrgenommen. Unserem Prinzen
Joseph, dem lediglich eine straffere militärische Organisation und eine effizientere Führung im Sonderraum an der
Militärgrenze vorschwebte, war die weitreichende Bedeutung seiner Erfindung ganz gewiss nicht bewusst, wie sie auch in
militärgeschichtlichen Erhebungen bislang kaum eine Rolle spielte. Deshalb haben wir Gelegenheit, heute Abend wenigstens in
einer Anmerkung sozusagen doch noch eine Welturaufführung zu reklamieren: Unser Held erscheint im hellen Lichte einer
weltpolitischen Dimension. Nämlich als erster praktischer Anwender der Doktrin des Partisanenkrieges - auch wenn ihm dieser
Umstand als Begriff von dieser eigenartig-einmaligen Sache gar nicht bewusst gewesen sein dürfte. Dennoch ist sie bis in
die jüngsten politischen Ereignisse hinein auf dem Balkan lebendig geblieben. Sie gehört - angesichts der damit verbundenen
enormen aktuellen politischen Probleme ein wenig unbeholfen gesprochen - von Kroatien über Bosnien bis in die Bukowina
hinein sozusagen zur wehrhaften Lebenserscheinung und bestimmt auch heute das spezifische soziale Klima der Balkan-Region
maßgeblich mit. Die auf diese Weise geschmiedete Klinge war für das persönliche Leben unseres Partisanen-Helden
zweischneidig. Obwohl er mit dieser Reform der Organisationsstruktur an der Militärgrenze sich bis nach Wien den Ruf eines
Sachverständigen in taktischen Fragen militärischer Praxis erwarb, fiel ihm sein Neuerungseifer aus ganz anderen, nämlich
typisch österreichischen Gründen doch auch auf die Füße. Die Grenzbauern im Sondergebiet waren unter militärischen
Gesichtspunkten keine Söldner, sondern eine geborene Mischung aus Miliz und Wehrpflichttruppen - in gewisser Weise zivile
Soldaten oder soldatische Zivilisten - Partisanen eben. Sie waren, was ihre von Amts wegen aufrecht erhaltene und
geforderte organisatorische Existenz und ihre Lebensweise betraf, Ausnahmeerscheinungen im Verhältnis zu Österreich-Ungarn
und zum übrigen Reich, und im Verhältnis zum österreich-ungarischen Militär und zu den im Reich existierenden Armeen
ohnehin. Die Aura des Partisanentums umschwebte alle, die mit der Militärgrenze in Berührung kamen, schon gar, wenn sie
sich dort ausgezeichnet hatten. Den langweiligen, überschaubaren und wohlreglementierten regulären Truppen, die sich ja
weitaus in der Überzahl befanden, waren die Militärgrenzer ihrer kaiserlichen Gunst-Privilegien, ihrer Großschnäuzigkeit
und ihrer Unbändigkeit halber ein von Neid durchdrungenes Misstrauen wert. Die Grenzer galten als unberechenbar, ihrem
Wesen nach als Aussätzige, sie waren die Schmuddelkinder des k.u.k. Militärs. Die Militärgrenzen-Offiziere hatten zwar dem
Generalkriegskommissariat gegenüber gute Karten. Doch waren sie hier auch isoliert von der übrigen Truppe, was bedeutete,
dass sie vom übergroßen Teil der Reichs-Militärmaschinerie geschnitten und für Beförderungen und andere karriereförderliche
Maßnahmen erst gar nicht vorgesehen wurden. Die Idee des Kleinkrieges und seiner militärorganisatorischen Durchsetzung war
denn doch zu gewöhnungsbedürftig für die Altherrenriege mit ihren Versammlungsbasen, Marschetappen, Stellungen, Magazinen,
Verbindungslinien und Festungen. Das Kriegführen bestand für diese Strategen nicht im Draufhauen und Verfolgen, im Hetzen
und Siegen, sondern in einem komplizierten Planspiel und Regelwerk, neben dem sich die logische Folge eines Schachspiels
zweier Großmeister ausnimmt wie eine Partie Mensch-Ärgere-Dich-Nicht. Auch an dieser barocken strategischen Doktrin ist
Prinz Joseph letzendlich bei seinem niederschmetternden Treffen mit Friedrich II. nahe Rossbach gescheitert. Er sah sich
nicht in der Lage, diesen schwerfälligen Leviathan von einer Reichsarmee auf Trab zu bringen, sie zum schnellen Handeln zu
bewegen. Er war ein Partisanenkommandeur. Um im Bild zu bleiben: Als Partisan war er an die aufbrausende Bewegungsform des
Achal Tekkiners, einer edlen Araberrasse gewöhnt. Als Oberkommandierender der Reichsarmee musste er sich mit dem schweren
Temperament eines bedächtig mit den Schinken wackelnden kaltblütigen Norikers begnügen und das war ihm fatal. Überhaupt
waren heiße Pferde seine Leidenschaft, wie er sich gern mit aufsteigenden Hengsten porträtieren ließ. Doch im wirklichen
Leben war die abgewirtschaftete Schindmähre sein Schicksal. Mit dem Ornat des Goldenen Vlieses und seinem Ruf als
rauhbeiniger Schlagetot von der Militärgrenze war er nun ein wirklich standesgemäß herausgeputzter Ritter von der
aufrechten Gestalt. Sein der adeligen Standesehre verbundenes Kapital war auf relativ sicherer Basis akkumuliert - mit
einem, nein zwei kleinen Makeln. Erstens: Er war nicht verheiratet. Und so konnte er auch kein Haus führen, wo sich die
Haute volee zum Salon einfand und all die verschwiegenen Treffen zur Pflege karrieristisch mitreißender Beziehungen
angezettelt und wohlgezielte Intrigen geschickt angerührt werden konnten. Der zweite Makel wog schwerer. Er hatte kein
Geld. Er lebte vergleichsweise bescheiden von seinem Sold, die finanziellen Aufwendungen für sein Regiment waren erborgt.
Wir beobachten ihn auf frischer Tat und können uns auch hier auf das allgemeingültige Prinz-Joseph-Prinzip des Treffens und
des letztendlichen Rückzugs verlassen. Beherzt also schritt unser stolzer Grenzgeneral zur Kür einer Braut. Wie nicht
anders zu erwarten war die auch noch stinkreich. Natürlich hatte die Sache einen Haken. Die Braut war schon etwas älter.
Einige Jährchen. Naja, eigentlich schon viele Jahre. Also, beim Licht der medizinischen Geschichtsschreibung besehen hatte
sie laut der allgemein gültigen Statistik der individuellen körperlichen Entwicklung in dieser Zeit die Wechseljahre
bereits ungefähr seit 7,5 Jahren glücklich überwunden. Genau genommen war sie schon 54. Doch - was für eine Partie. Sie
hieß Anna Victoria von Savoyen-Carignan Gräfin von Yvoi und Soissons von Frankreich (1684-1763) und war keine geringere als
die Nichte des Türkenschlächters Prinz Eugen von Savoyen. Die punktgenaue Landung bestand darin, dass die Dame die Erbin
des Vermögens des Prinzen Eugen war und das hatte nach allem, was darüber zu finden ist, unermessliche Dimensionen.
Eigentlich hatte Prinz Eugen, der mit sich und seinen Schlachten genug zu tun hatte und also keine Zeit, Weibern und
anderem Gedöns seine knappe Freizeit zu opfern, seinen Großneffen Johann Eugen Franz (1714-1734) zum Haupterben eingesetzt.
Der junge Mann allerdings starb zwanzigjährig im November 1734 und der - wie schon gesagt - schon etwas tüttelige Prinz
Eugen versäumte es, ein neues Testament aufsetzen zu lassen. Nun fiel das ganze bewegliche und unbewegliche Gut an die
einzige noch lebende Angehörige, eben Victoria, die Tochter des Bruders. Diese war zeitlebens ledig geblieben, hatte ihre
Zeit in einem Kloster verbracht und war nun Herrin über das Belvedere und das Stadtschloss in Wien, die Residenz Schlosshof
und die Güter auf dem Marchfeld zwischen Bratislava und Wien, die eugenische Bibliothek und Gemäldesammlung und ein
Barvermögen im höheren achtstelligen Bereich. Die Reiche und der Held fanden sich dort zusammen, wo die Reiche an der
Heldenehre und der Held am Reichtum - im neudeutschen Ökonomenchinesisch gesprochen - komparativ miteinander
kommunizierten. Prinz Joseph konnte mit seiner barocken Statur zwar von fern Eindruck bei Frauen schinden, dennoch stellte
er keinen schönen Mann im landläufigen Sinne vor. Er mag der ganzen Geschichte mit der Dame von vornherein misstraut haben,
wie ja auch im Nachhinein von Schauspielerinnen und Sängerinnen in seiner Nähe schon, von Standesfrauen eher nichts zu
hören und zu sehen war. Im öffentlich-gesellschaftlichen Umgang konnte er durchaus galant und charmant sein, doch zu Hause
war er doch lieber unter Uniformbrüdern, kroatischen Saufbauern oder mit seinen Jagdhunden zusammen. Bevor er sich also das
zarte Ja-Wort abverlangen ließ, nötigte er die Braut, ihm die Güter und die Residenz Schlosshof im Gesamtwert von nahezu
einer Million Gulden und ein für den Betrieb der Anlagen nötiges Taschengeld von etwa 300.000 Gulden vertraglich zu
überschreiben. Was die Heiratswillige auch unumwunden tat. Damit, das war gewiss, konnte diese Ehe wenigstens für sein
weiteres Auskommen gut sein. Außerdem schenkte ihm Victoria das Schwert des Prinzen Eugen, ein wertvolles Geschenk der
Königin Anna von England (1665-1714), ein Indiz dafür, dass die Braut meinte, Prinz Joseph werde mit diesem Ehrenzeichen
militärischen Wirkens stolz in den teuren Fußstapfen ihres verblichenen Verwandten einherwandeln. Nun, Verliebten ist nicht
zu raten. Doch so viel können wir vorgreifen: Erfüllt haben sich diese Hoffnungen auf die Eugen-Nachfolge nicht. Im
Türkenkrieg, wir sahen es bereits, war die Sache so lala ausgegangen, und den Erfolgen an der Militärgrenze blieben
allenfalls Würdigungen im kleineren Kreis vorbehalten. Als Oberbefehlshaber der Reichsexekutionsarmee war Prinz Joseph eine
glatte Fehlbesetzung. Und auch mit dem Gedöns hielt es nicht lange an. Denn sechs Jahre nach der standesgemäß prachtvoll,
doch auch verschämt still am 17. April 1738 in Schlosshof abgefeierten Hochzeit bat die von dem massigen Grobian
enttäuschte Victoria nach ohnehin schon zwei Jahren getrennter Wege um die Scheidung. Das Geschenkte behielt er natürlich.
Denn das Geld - Maria Theresia kaufte ihm Schlosshof ab, damit das teure Erbe des Prinzen Eugen nicht in unwillkommene
Hände geriete - konnte er nur zu gut brauchen. Schließlich hatte er gesellschaftliche Verpflichtungen. Immerhin lebte es
sich mit Geld angenehmer als ohne, gleichgültig woher es kam, denn bekanntlich stinkt es nicht. Die der Welt recht fremd
gebliebene Victoria starb 1763 ziemlich ärmlich im achtzigsten Lebensjahr. Sie konnte noch nicht einmal ein Grabmal für
ihren Onkel, den Prinzen Eugen bezahlen, der ihr all die enormen Reichtümer hinterlassen hatte. Prinz Joseph indes ließ
sich ohne Zögern rechtzeitig als Besitzer der geschenkten Schlosshof-Immobilien eintragen und siedelte auf dem Grund
Familien von seiner kroatischen Militärgrenze an. Die wilden Bauern dankten ihm die erwiesenen Wohltaten, dass er ihnen
Land gab und sie aus dem permanent unsicheren, von täglichem Terror erschütterten Militärbezirk aufs beschauliche Marchfeld
holte, mit unbedingtem Gehorsam. Sie waren brav und redeten ihn auch stets mit Herzog an, eine kleine Schwäche, mit deren
Hilfe der Chef sich die Seele pinseln und ihn butterweich werden ließ - und der er auch in Hildburghausen, wo er so richtig
einen guten Herzog spielen durfte, nicht entraten mochte.
...
|
|
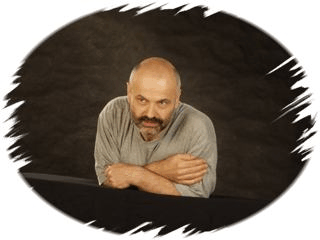 |
|