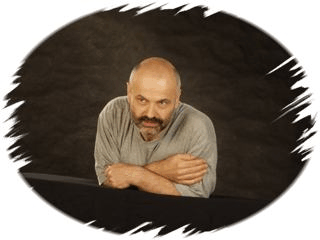|
Theaterkritik Shakespeare
|
Mächtige. Menschen. Mörder.
Die Idee ist nicht neu. Sie umzusetzen braucht es viel Mut. Sie birgt mancherlei Unwägbarkeiten, zu denen beispielsweise
die Verschwommenheit collagierter Texte gehört und der Vorwurf, es bögen sich ehrgeizige Theaterleute unanfechtbare
Entwürfe nach Gutdünken zurecht. In der Inszenierung von Schauspieldirektor Karl Georg Kaiser Mächtige. Menschen.
Mörder., für die der Regisseur gemeinsam mit dem Dramaturgen Michael Truppner die sogenannten Historien von William
Shakespeare König Richard der Dritte (1593), König Richard der Zweite (1595) und König Heinrich der Vierte.
Erster und zweiter Teil. (1597) beim Nachdenken über die Frage nach den Mechanismen und der Legitimation von
Herrschaft (Programmheft, S.30) zusammenführte, entsteht ein opulentes, wenngleich auch ein widersprüchliches Bild. Die
Zusammenschau der drei für sich schon überdimensionalen Werke sprengt alle für ein Theater dieser Größenordnung
herkömmlichen Ausmaße. Viereinhalb Stunden konzentrierte Textarbeit erschöpfen auch den willigsten Theaterbesucher und
irgendwann geisterte die Frage durch die Reihen, wie lange das denn noch dauern mag, worauf prompt die Antwort kommt, es
sei im mindesten nicht vorher damit zu rechnen, als bis der König mausetot auf den Brettern liegt. Shakespeare im
Dreierpack, da braucht´s Geduld. Denn wie bei allen längeren barocken Gebilden der unterhaltenden Mitteilungsbranche
schauen an irgendeinem Punkt die Formen und Gestalten aus wie durcheinandergeschlungene Ornamente, Auge und Ohr weigern die
Aufnahme im Einzelnen und wenden sich mehr niedergedrückt als gehoben ab von diesen überdies oft akustisch nicht immer klar
verständlichen Auskünften über beklemmende Aufschwünge und hochgestochene Niederträchtigkeiten - das Bühnengeschehen wirkt
von diesem Punkte an als Ergebnis einer ziel- und regellos arbeitenden Einbildungskraft, die nur darstellt, um sich selbst
darzustellen. So entsteht mehr und mehr ein Machtspiel im leeren Raum, eine Bewegung an sich. Politische Macht, um sie geht
es den Königen bei Shakespeare immer, ist keine spielerische Größe außerhalb konkreter Verhältnisse, kein Wert an sich. Es
steht immer die Frage nach der Gerichtetheit der Macht - von wem, zu welchem Zweck, über wen. Diese Fragen bleiben in
dieser Inszenierung unter den Trümmern der drei Shakespeare-Stücke verborgen. Mit Notwendigkeit biegt deshalb das Ganze
sich in Teilen um ins Sentimentale, ins Persönlich-Individuelle, dorthin, wo es die Königsebene des Tragischen verlässt und
das Pantoffelniveau der hehren Beleidigungen erreicht. Der Versuch einer für uns Heutige eingerichteten Shakespeare-Collage
scheint mir trotz eines enormen Aufwandes an respektabler Arbeit aller Beteiligten letztendlich gescheitert an einer
Konzeption, die den intellektuellen Anforderungen der Gegenwart nicht im Mindesten gewachsen ist. Um im Bild zu bleiben:
Sie bewegt sich zwischen den Schlagzeilen über das Verstummen des Gesprächs, das Georgie und Gerd nicht miteinander führen
und dem mit drei Jagdtrophäen verzierten Klassenzimmer-Tableau, in dem Shakespeare-Verse gepaukt und gewitzte Fragen
abgewürgt werden, bis die Bühnenwelt aus den Spinden quillt. Voraussetzungen, die bestenfalls als Posse durchgehen mögen.
Für diese nachteiligen Momente entschädigt finden sich die Zuschauer von einigen sensationellen schauspielerischen
Angeboten. Dietmar Horcicka verleiht seinem Richard II. eine Zerrissenheit, die bis in sein empfindsames Naturell
hineinreicht. Richard ist ein vom Missgeschick verfolgter junger Mann, der einen König vorstellt, der sich im Spiegel
seiner selbst nur als verzerrt erscheinenden jungen Mann gewahrt und der einsieht, dass er kein König mehr sein kann. Seine
Unfähigkeit zu königlichem Handeln geht ihm selbst auf die Nerven, er schwankt zwischen Aufbegehren und Selbstmitleid.
Dietmar Horcicka bricht mit äußerster Prägnanz mimische Vorgänge übergangslos ab und fällt sofort in gegenteilige
Stimmungen ohne zu überzeichnen und ohne die Figur zu beschädigen - sein Richard II. bleibt trotz schroffer Wechsel
sympathisch bis zum Ende. Die beiden Teile Heinrich der Vierte auf ein königsgerechtes Maß einzuschrumpfen kann ohne
Beschädigungen kaum gelingen. So steht Hans-Joachim Rodewald vor der nahezu unlösbaren Aufgabe, dem, was von seiner Rolle
noch übrig ist, das Gepräge Heinrich IV. zu geben. Er darf keine Reden schwingen, nicht in die Kneipen gehen, er darf sich
nicht im Kontrast zu Heinrich Percy (Michael F. Stoerzer) sonnen und vor allem bleibt er ohne Kontakt zu Falstaff. Und
trotzdem entsteht wie durch ein Wunder die ambivalente Figur eines Schaumschlägers, der durch all seine Scheinheiligkeit
sich selbst zu Fall bringt. Hans-Joachim Rodewald vermag es, allein durch Körpersprache und wenige Sätze die Larmoyanz und
das gespielte Abgeklärte des Emporkömmlings herauszustellen, der den Verrat ringsum vor eitler Selbstgefälligkeit nicht
wahrnimmt, sich schließlich insgeheim seine Fehler eingesteht und stirbt, nicht ohne dem Heinrich Percy voll Wehmut die
Krone rechtmäßig überlassen zu müssen. Als Richard III. betritt Helge Lang die Bühne. Wenn er beginnt, vom Ende des Winters
seines Missvergnügens zu berichten und hernach die stolze Witwe Anna (Katherina Wolter) am Sarge ihres ermordeten Mannes
verführt, schreitet eine der Musen durch das Theaterrund. Hier bringt das zarte Gewicht eines Schauspielers das Atmen eines
ganzen Zuschauersaales zum Stillstand. Helge Lang zelebriert mit Geduld und Würde diese goldene Rolle und alle sind gebannt
von der sinistren Eleganz, dem zynischen Frohsinn, dem Mut eines Zockers und dem verächtlichen Hohn des Mörders für seine
Opfer. Allein um dieser Szenen willen ist das Dreifachprojekt nicht ganz vergeblich gewesen. Die Art der Inszenierung
bringt es mit sich, dass die meisten anderen Figuren überwiegend statisch agieren, sie sind lediglich Sprachröhren des
Bühnengeistes - die Schauspieler treten nur mehr als ihre Träger hervor, die ihre Texte aus der akustisch unvorteilhaft
konstruierten Bühne in die Zuschauerreihen rufen müssen. Der Verständlichkeitsnachteil gilt auch für den zur
Zwischenspielfigur degradierten Sir John Falstaff aus Heinrich der Vierte. Er begleitet mit Poins (Holger Schmidt),
Bardolph (Wolfgang Pfister) und dem Prinzen von Wales (Jan Krawczyk) die beiden Teile vor dem Schlussstück um Richard III.
Jan Mixsa führt Falstaff als überlebensgroße Puppe sehr souverän, charmant, fettleibig, agil, durchtrieben - eine
akustische Verständlichkeitshilfe hätte vieles erleichtert. Darum, dass die Idee für ein zusammenfassendes Shakespeare-
Projekt nicht neu ist, bleibt doch die praktische Umsetzung auf der Bühne ein dramaturgischer Kraftakt, eine quantitativ
beeindruckende Regieleistung und eine achtenswerte Anmutung an jeden ernsthaften Schauspieler. Fragen bleiben. Was bringt
uns diese massive Shakespeare-Ansammlung heute? Sind die shakespeareschen Dramen geeignet zu Selbstbedienungsregalen für
ehrgeizige Dramaturgen und Regisseure? Hat das Publikum verstanden? Mehr Fragen, mehr Probleme. Shakespeare lässt grüßen.
Klaus Brückner
|
|
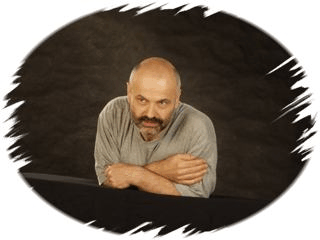 |
|