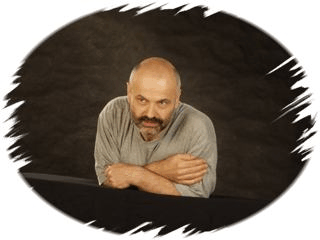|
In der Mühle
|
...
Frankreich, das war ein Wort, das besonders am Sedantag Großvaters Augen leuchten ließ. Und mir schien, als sei es
ein Land, in dem all die guten Wünsche aus den Märchen bereits in Erfüllung gegangen waren. Dort gab es ein Brot, das so
duftete, da lief einem das Wasser im Munde dermaßen zusammen, dass kein Tropfen Kathreiner-Kaffee nötig war, um das Essen
hinunter zu spülen. Niemand trank dort die bittere Brühe aus dem Sud der gerösteten Gerste. Wenn einmal der seltene Fall
des Durstes aus Mangel an erquicklichem Brotduft eintrat, so griffen sie dort zum Weinkrug, der niemals leer wurde,
jedenfalls konnte sich mein Großvater an ein solches Vorkommnis nicht erinnern. Und der Wein, das war etwas ganz
Besonderes. Er war also, in gewisser Weise, wie konnte er das beschreiben, mein Großvater, also, der Wein, der war eben
französisch. Ja, so richtig französisch. Und komisch, jedes Mal, wenn er dem Wein zugesprochen hatte, waren da auch die
schönsten jungen Frauen, die sich ein Mann nur vorstellen kann. Natürlich hatte mein Großvater zu Hause seine Verlobte,
meine Großmutter. Doch schon allein vom Hinsehen konnten einem bei diesen Mädchen die Augen übergehen, sie waren, das
konnte mein Großvater nicht ohne Weiteres in Worte fassen, so schön, so adrett, so, wie sollte er sagen, französisch, ja,
sie waren französisch, diese Weibsbilder, wie Milch und Blut. Die kamen, und hatten immer einen frischen Käse dabei oder
eine fein geräucherte Wurst oder dieses Brot und gelbe Butter und hin und wieder auch Marmelade mit ganzen Früchten und
Rumgeschmack. Und ja, auch Schnecken manchmal, das war ein Nationalgericht und unterschied sich von Spitzbein in gewisser
Weise nur durch die fehlenden Knochen. Doch nie sprach er von Pickelhaube und Tornister, Stiefelwichse und Gewehr. Ihn
hatten die Dörfer begeistert, die Menschen, die französischen Soldaten und die Frauen. Der Franzmann ist ein tapferer
Soldat. Und seine Frauen, ja, die übertreffen alle Tapferkeit durch ihre Schönheit. Dabei strich er sich geziert die
Augenbrauen und schielte, ob Großmutter in der Nähe war. Die schaute denn auch regelmäßig mit gerunzelter Stirn um die
Ecke, halb gespielte Entrüstung. Sodann schnalzte Großvater mit der Zunge, herausfordernd, mit forschem Franzosenblick und
wildem Aufstampfen, Kosakentanz. Gewittergleich brauste aus der Ecke ein Protest heran, von wegen der gottlosen Reden vor
dem Kind. Das war das Zeichen zur gemeinsamen Flucht direkt in den Gasthof Zum wilden Mann, wo Großvater sich in hoher
Stimmung den Bierschaum aus dem Schnurrbart wand und ich unter dem Gelächter der Männer, die genüsslich im Pfeifen- und
Zigarrenrauch husteten, am Krug nippen durfte. Das Bier schmeckte bitter, aber es machte bei ausreichender Menge auch
beschwingt. Deshalb tat ich immer so, als widerte mich die Brühe an, zog aber einen mächtigen Schluck durch die Lippen und
wartete, bis das Gefühl im Kopf ankam. Zu Hause schimpfte Großmutter. Großvater lachte und versprach, dass ich sehr gut
schlafen werde. Da hatte er Recht. Auf dem Weg vom Wirtshaus nach Hause, der sich in der Dunkelheit hinzog, hatte er mir
die rätslhafte Mühlengeschichte erzählt, die ich immer am Sedantag mit in den Schlaf nahm. Auf einer Anhöhe hinter Frenois,
knapp fünf Kilometer vor Sedan, stand eine holländische Mühle mit einer Galerie, von der aus die Flügel bespannt werden
konnten, und einer Rosette, die die Haube automatisch in den Wind drehte, ohne dass der Müller beim Mahlen unterbrechen
musste, wenn der Wind wechselte. Sie bestand aus einem wunderbaren runden Turm, hatte eine ganz flache Haube und bewegte
sich fast spielerisch im Wind. Stundenlang saß ich da und beobachtete die wuchtige Leichtigkeit, mit der sich das
Flügelwerk drehte und der Wind seine Arbeit tat. Der Müller trat gelegentlich auf die Galerie, schaute in die Runde,
hustete und schneuzte sich und verschwand wieder in seinem Turm. Er hieß Paul Corbiere und war in dem Dorf Frenois ein
angesehener Mann, weder zu arm noch zu reich, doch war an der Mühle zu sehen, dass er seinen Besitz in Schuss hielt. Ein
Handwerker nach meinem Geschmack. Ich sammelte meine paar Brocken französisch und er klaubte sein bisschen deutsch zusammen
und war erstaunt, in der ein wenig ramponierten Uniform einen Schmied kennen zu lernen. Er war weit und breit der einzige
Müller, die anderen Mühlen hatten ihr Geschäft aufgegeben. Die Händler in den Städten kauften ihr Mehl in den modernen
Großmühlen, die mit Wasserkraft angetrieben wurden und enorme Mengen Getreide verarbeiten konnten. Er lebte noch von den
unsicheren Erträgen der Bauern in der näheren Umgebung, doch das Geschäft war mager. Paul Corbiere sagte: Krieg nimmt Gut
weg, Krieg nimmt Mut weg, Krieg nimmt Blut weg. Und Großvater nickte dazu, Krieg macht einen reich und zehn arm. Der Müller
Paul war ein stattlicher Mann, mit kräftigen Armen und einem Gesicht, dem Frauen nicht widerstehen können, weil es hinter
den offen blickenden Augen eine unbestimmbare Melancholie vermuten ließ, die sofort das allgemeine Gluckenwesen aufrief, zu
helfen und zu trösten. Paul war fleißig und die Mühle war sein ein und alles, ein Schmuckstück. Er mag nicht der
Gewitzteste gewesen sein und ihm fehlte im Umgang mit anderen Menschen das zupackende Temperament ganz. Er war immer
zurückhaltend, auch bei Gelegenheiten, die ein wenig Leidenschaft von ihm gefordert hätten. Ja, es schien zuweilen, als
wäre er einfältig, als könnte er nicht immer ganz verstehen, was ihm andere zumuteten. Die Mühle war seine Welt, und die
war ihm genug. Viele in Frenois oder in der Umgebung, in Donchery, in Wadelincourt oder in Cheveuges, die keinen engeren
Umgang mit ihm pflegten, hielten ihn für ein Mondkalb. Seine Frau war Ariane, die Tochter des Schmiedes Philippe
Clerambault aus Francheval, um Etliches jünger, ein Bild von einem Weib, stramm, ebenmäßig im Gesicht, kastanienbraune
Haare, die in der Sonne leuchteten wie Feuer. Sie war aber nicht nur schön, sondern auch hell im Kopf, so dass Großvater
sie immer mit Großmutter verglich, aber hinzufügte, sie sei also in gewisser Weise, wenn das geht, auf andere Art
mindestens genau so schön gewesen wie Großmutter seinerzeit. Und das, schien mir, wollte etwas heißen, was mir
unverstellbar war. Denn Großmutter war um ihrer äußeren Erscheinung willen in jungen Jahren bei Schulaufführungen immer die
Rolle des Dornröschens zugefallen. Als Beweis legte sie eine auf steife Pappe gezogene, perlmuttfarben schimmernde
Photographie vor, die sie als Braut gekleidet zeigte. Ihre Grazie entsprach vollkommen ihrer Natur, mir fiel dazu in
späteren Jahren nur diese romantische Bezeichnung ein, die Hinde, eine ungezähmte Würde, wild und sanft zugleich. Dieses
Bildnis schaute ich immer wieder an und es blieb mir bis heute ein Rätsel. Das war meine Großmutter. Nicht wie ich sie
kannte, sondern wie sie Großvater einst bezaubert hatte. Ich kann mich an ihrer heiteren Schönheit nicht satt sehen. Ariane
Corbiere nahm im Mühlenhaushalt schnell das Ruder in die Hand. Ihre Schlagfertigkeit setzte sie ein zur Verteidigung ihres
Hauswesens und ihre Umsicht verschaffte ihr den Respekt der meisten Leute von Frenois. Sie stellte sich auch vorbehaltlos
schützend vor ihren Mann, wenn der einmal mehr nur sanft lächelnd eine Unverschämtheit parierte oder eine Frechheit
abwinkend in Kauf nahm und wortlos im Sackboden seiner Mühle verschwand. Paul indes war nicht nur im Übermaß aufmerksam und
fleißig in seiner Mühle, sondern seine breiten Rippenbögen umspannten auch ein Herz weich wie Butter. Gegen Frauen, die in
seinen Augen zu lesen verstanden, konnte er keine Widerstandskraft aufbringen. So zeigte es sich in gegebenen Augenblicken,
dass Ariane, überströmt von Verlangen, vollkommen allein auf dem Trockenen stand, während Paul mürbe und kleinlaut den Kopf
hängen ließ. Dabei legte sich sein Eifer nicht auf eine Göttin seiner Wahl, sondern die eifrigen Göttinnen wählten Paul zu
ihrem Allgemeingut. Er lieferte mit seinem Gespann das Mehl auf die Höfe und bei seiner Wiederkehr saß er zwar weniger
gerade auf seinem Bock, dafür aber verlegen lächelnd, wie ein Kind, das ganz unerwartet mit seiner Lieblingsschokolade
beglückt worden war. Es gab Munkeleien in Frenois und Umgebung, dass eine ganze Generation von Kindern mit krausen Haaren
und diesem zaghaften Lächeln heranwuchs. Doch darauf schien Ariane nicht viel zu geben, im Gegenteil. Immer wenn ihr wieder
einmal im Vertrauen dies und jenes zu Gehör gebracht wurde, antwortete sie trocken, wer für mich arbeitet, ist meine Magd.
Aber Paul trug noch ein Geheimnis mit sich, das über die Frauenschaft von Frenois hinausging. Er war Müller und konnte sich
darauf berufen, dass zwischen seinen Mahlsteinen täglich ungezählte Welten zugrunde gingen, um in strahlender Weiße neu zu
erstehen. So war es nicht verwunderlich, dass seine Sicht der Dinge mit zunehmendem Alter in eine philosophische mündete,
mittels derer er sich ganz unbewusst die stark anregenden Wurzeln der griechischen Dichter und Denker neu anzuwandeln
verhieß. Ihm schien sich ein ganzer Kosmos menschlicher Zuwendung zu öffnen, wie das bei Martialis treffend geschrieben
steht, Wenn Briseis auch oft ihm willig den Zugang gewährte, - Zog Aeacus´ Enkel den zarten Freund ihr doch vor.1 Als
Ariane diese Eigenschaften ihres Gatten vollends gewahrte, beobachtete sie ihn genauer und stellte ihn eines Tages zur
Rede. Sie sprach sanft und leise mit ihm, so, wie er es von ihr gewohnt war. Sie wolle nicht neben ihm stehen wie eine mit
Krätze. Auch ihr gebühre die eheherrliche Zuwendung. Sie liebe ihn sehr und sollte von ihm, der behauptet, sie auch zu
lieben, die leibliche und greifliche Offenbarung seiner Zuneigung erwarten können. Sofern er sich nicht dazu in der Lage
sehe, würde sie alles tun, dass sie, die seine Kälte als Unheil empfinde, hinfort nicht mehr zu derartigen Klagen genötigt
sei. Paul nickte freundlich mit dem Kopf und hob ein wenig verlegen die Schultern, erwiderte aber nichts. Wie sich zeigte,
trieb Ariane weiter ohne die Segel erfüllter Leidenschaft ausspannen zu können ziellos über die Wogen des Lebens. Paul
indes wartete seine Mühle vorbildlich, mahlte pünktlich, lieferte zuverlässig und gab auch weiterhin seinem Publikum alles,
was es begehrte. Als hätte das Gespräch nicht stattgefunden, lebten die beiden nach ihren hergebrachten Umständen. In
Ariane allerdings lauerte die Kraft einer gesunden jungen Frau, die nicht bereit war, ihr Leben in den Windschatten der
Mühle zu stellen. Während Paul mit den Gesellen das Korn der Mahlgäste entgegennahm, wog, in die Mahlpost eintrug und die
Säcke mit dem Aufzug auf den Schüttboden hievte und dort stapelte, kümmerte sich Ariane mit den Mägden um Küche und Garten,
die Versorgung des Viehs, das Waschen der ewig verstaubten Kleider und zur Erntezeit half sie auch beim Registrieren des
Mahlguts, denn da war besonders Not am Mann. Paul hatte ständig den Wind im Ohr, so dass er beim Beginn des Mahlgangs die
Flügel genau nach Bedarf einrichten konnte. Das Korn musste oben gleichmäßig nachgeschüttet, das Mehl unten schnell und mit
sicherer Hand in Säcke aufgefangen und über die Waage exakt abgepackt werden. Dann lagerte es in Stapeln sicher auf dem
Sackboden, bis Paul es dann am Morgen auslieferte. An jedem Mahlabend folgte das große Saubermachen bis die Planken
glänzten. Die beweglichen Teile sicherten die Gesellen, indem sie die Flügel in Kreuzstellung brachten, die Lamellen aus
dem Wind nahmen und die Königswelle arretierten. Dann nahmen sie vorsichtig das Beuteltuch aus dem Kasten, durch dessen
Maschen das Mehl in den Mehlkasten fällt. Die Kleie bleibt oben und wird rüttelnd über das vom Beutelkasten verdeckte Tuch
in den Vorkasten geleitet. Das grobe Gemisch aus den härteren Kornbestandteilen musste in Säcke abgefüllt werden, weil es
den Bauern als Viehfutter diente, in schlechten Zeiten aber backten es die Frauen auch ins Brot als Sattmacher. Das
Beuteltuch klopften und zupften die Gesellen peinlich sauber. Vor allem die hartnäckigen Spelzen und Grannen forderten
ihnen viel Geduld ab, weswegen die älteren Gesellen diese Arbeit gern den Lehrbuben auftrugen. Wöchentlich schmierten sie
die Wellenlager gründlich und je nach Mahldauer und Beschaffenheit des Korns übernahm es Paul, die Mahlsteine sorgsam zu
schärfen. Nachdem Paul bei Einbruch der Dunkelheit von seinem feierabendlichen Kontrollgang herabkam, setzten sich alle,
Müller, Müllerin, Gesellen und Mägde an den langen Tisch im Erdgeschoss und beendeten den Tag, indem sie bei weißem Brot,
Milch, Käse und Fleisch kräftig zulangten und sich untereinander Blicke zuwarfen. Dann verabschiedeten sie sich und Müller
und Müllerin gingen in ihre Schlafstatt ein. Ariane wusch sich gründlich, zog ihr besticktes Barchentgewand über und legte
sich auf ihre Seite. Da seufzte sie auch noch als Paul nackt von seiner Dusche unter der Brunnenpumpe kam, das Nachthemd
überzog und auf seiner Seite niedersank, wo er binnen eines Augenblicks schlief, ohne die gefalteten Hände noch
auseinandergenommen zu haben. Die finanziellen Obliegenheiten der Mühle waren schon in der Verlobungszeit schnell in die
Hände Arianes übergegangen und mit ihrem Eintritt nach der Hochzeit übernahm sie das Regiment vollends. Sie rechnete
schnell und entschied nach kurzem, entschlossenen Nachdenken über die alltäglichen Einkäufe, das Ausmaß der fälligen
Schmiede- und Zimmererarbeiten an den Flügeln, der Haube, dem Beutelkasten und den Fuhrwerken, den Lohnzuwachs bei den
Gesellen und Mägden. Sie sorgte auch dafür, dass die Einnahmen stimmten, sie kalkulierte vorausschauend Löhne, kurzfristige
und langfristige Kosten und Investitionen, so dass Paul ein Stein vom Herzen fiel. Denn dieses ewige Rechnen und das
Bedenken aller Widrigkeiten und die Berücksichtigung der schlimmstenfalls zu erwartenden, weniger erbaulichen Umstände
waren seine Sache nicht. Er neigte dazu, den Dingen ihren Lauf und sich selbst überraschen zu lassen. Dabei war er sich
dunkel bewusst, dass ihm diese Alltagsfeigheit langfristig schaden würde. Die Überwindung, diese ungeliebten Arbeiten doch
noch zu erledigen, kostete ihm viel Kraft. Doch nun hatte er seine Frau, die das Geschick der Mühle wie ein Rosettenrad in
den richtigen Wind drehte. Der Kopf blieb ihm frei und das Herz leicht seit er verheiratet war. Das war zwar die
Wirklichkeit, doch, so schien es ihm, auch ein wenig wie ein schöner Traum. Am schönsten war es, wenn Paul von der
nächtlichen Dusche kam, das Nachhemd beiseite ließ und sich zu ihr legte. Dann vergaß sie die Gerüchte und die schoflen
Blicke und hegte immer wieder Hoffnung. Doch war das eben viel zu selten, denn der Mond wechselte öfter und sie begann zu
leiden. Nach einem eher geruhsamen Winter, der weder besonders streng war noch erwähnenswerte Außergewöhnlichkeiten mit
sich brachte, schneite mit den ersten Blütenblättern ein Müllergeselle auf den Hof, der nicht mehr der Jüngste war und auch
im Französischen mehr schlecht als recht zu Hause schien. Wie sich zeigte, kam er aus Tirol, durchstreifte das Land auf
Wanderschaft und wirkte erfreulicherweise älter als es die Daten in seinen Papieren wissen ließen. Ariane handelte in einem
Zug und der Fremde hatte sich verdingt, noch bevor ihm so recht klar war, zu welchen Bedingungen er eigentlich in ihre
ausgestreckte Hand eingeschlagen hatte. Ein paar Tage später hatten alle nach eingehender Prüfung und schärfster
Beobachtung die unumstößliche Gewissheit erlangt, dass der schwarze Tiroler gewissermaßen die Arbeit nicht erfunden zu
haben schien. Doch bei aller Skepsis hinwiederum mussten auch die scharfäugigsten einräumen, dass er gewissermaßen ein
besonderes Geschick beim Umgang mit der Mühlentechnik an den Tag legte. Nach der eingehenden Besichtigung des Mahlwerks und
einer geradezu zauberischen Herumklopferei an den Steinen, rüstete er ein Maultiergespann, packte sich ordentlich
Verpflegung in den Wagenkasten, bat der Chefin unumwunden eine mittelgroße Summe Geldes ab und verschwand mit der leichthin
über den Morgentisch geradebrechten Bemerkung, er begebe sich gen Westen und sei in ein paar Tagen wieder zurück. Paul
beobachtete den von unsichtbaren Strömungen begleiteten Vorgang lächelnd mit seinem einfältig wirkenden Achselzucken. Die
Mägde und Gesellen hingegen wussten bei dieser neue Lage kaum an sich zu halten. Ihr Urteil oszillierte je nach Tageszeit
und Stellung der Windfahne zwischen abgrundtiefer Verwunderung und höchlichster Empörung. Nach zwei Wochen stand der
Tiroler mit stolzgeschwellter Brust und müden Maultieren wieder im Hof. Auf dem Wagen lagen etliche Steine, gut gepolstert
und in Holzgestelle gezurrt. Er behauptete, nahe bei Paris gewesen zu sein, genauer in La Ferte sous Jouarre - er sprach
von Laffärtsutschahre -, wo es diese Steine gäbe, die sich dank ihrer ungewöhnlichen Kristallstruktur für alle
Getreidearten bestens eigneten und dabei auch in Zeiten höchster Beanspruchung niemals geschärft zu werden brauchten. Und
das Beste an ihnen sei ihre Lebensdauer, nämlich in den hier vorliegenden Dimensionen an die hundert Jahre und mehr. Wenn
das nicht stimme, so sollen ihn dereinst die Gesellen auf die Flügel flechten und so lange durch den Wind treiben, bis
seine Knochen einzeln herunterklimpern. Alle trollten nach dieser starken und nicht an allen Stellen leicht verständlichen
Rede an ihre Arbeit, tippten, jeder für sich, an ihre Stirnen und verstanden so einander auch ohne Worte. Der Schwarze
baute ein Gestell, wie es oft auf Dorfplätzen errichtet wird, wenn ein Fest ausgerichtet und zum Tanz aufgespielt werden
soll. Darauf legte er mit einer Dreibockwinde ziemlich geschickt die Steine ab. Jeden Abend, nachdem der Mühlenbetrieb
abgeflaut war, ging er hinüber auf sein Gestell, umkreiste die Steine, kratzte sich hinterm Ohr, bückte sich, wälzte die
Brocken hin und her, kniete sich daneben und rauchte eine Zigarette nach der anderen, was als modisches Getue bei den
Mägden abschätzig bezischelt wurde, denn anständige Männer rauchten Pfeife oder Zigarre, nicht diese weibischen
Papiernudeln, wendete hier einen Stein, rollte dort einen anderen quer über den Gestellboden oder stand dann wieder da wie
ein Boule-Spieler bei der Kombination einer ganz raffinierten Wurf-Variante. Beim Übergang der Dämmerung in die Nacht nahm
er ein altes Beuteltuch, deckte sein Werk sorgsam zu und beschwerte die Ränder mit Kieselsteinen. Der abendliche Tanz mit
den Steinen dauerte zwei Wochen. Dann kramte der Tiroler aus seinem Rucksack eine Mühlpille, einen flachen Meißel und einen
anderen Hammer hervor und kniete nun im Abendschatten auf seiner Tribüne, hieb auf die Steine ein und ließ, je mehr das
Licht verging, um so heller die Funken sprühen. Er schien von den Steinen besessen, denn auch der stärkste Regen konnte ihn
nicht hindern, an den Steinen herumzuklopfen. In den Mahlpausen, wenn der Wind zu schwach war, ging er mit seinen Hämmern
und dem Meißel nach Frenois zum Schmied. Und nachdem er ein paarmal dort war, kam der Schmied von selbst auf den Mühlenhof,
um mit eigenen Augen zu sehen, was der seltsame Mann mit diesen Werkzeugen eigentlich trieb. An der Esse jedenfalls wusste
er genaue Anweisungen zu geben sowohl was die Glühfarbe des Metalls betraf als auch die exakte Abfolge der Kühlfarben. Der
Schwarze tänzelte dann wie ein aufgeregter Kater in seiner Schmiede herum, wenn er in kleinen Intervallen mit den glühenden
Enden der Hämmer oder des Meißels das Wasser in seinem Löschbottich zum Brodeln brachte. Das Werkzeug war gut, der Stahl
ungewöhnlich hart. Das konnte nur jemandem gehören, der sein Handwerk verstand. Sowas weckte natürlich auch die Neugier
eines Schmiedes. Zuerst umkreiste der Schmied das Gestell. Dann nahm er eine Zigarette von dem Tiroler, steckte sie an und
verzog das Gesicht, paffte sie aber tapfer bis er sich die Lippen verbrannte. Er bestieg die Plattform, beäugte die Steine
von oben, von schräg und von der Seite. Den weitausholenden Armbewegungen des Schwarzen kreiste der Kopf des Schmiedes
hinterher, den kniffligen Fingerübungen folgte er gebannt mit den Augen. Am Ende rauchten sie gemeinsam und nickten sich
gegenseitig verständnisinnig zu. Am nächsten Tag erschien der Schmied mit einem Messrad und einem Beutel mit Kreidestücken.
Mit dem Rad fuhr er die Runde der Steine ab und markierte mit Kreide eine Stelle auf dem Rad. Sodann stieg er auf den
Mahlboden, legte das Mahlwerk frei, setzte einen Kreidestrich auf den Stein und ließ das Rad die Runde mitlaufen. Dann
brachte er voller Befriedigung über das Ergebnis seiner Forschungen einen erneuten Kreidestrich auf seinem Messrad an und
baute den Mehlkasten wieder zusammen, unter dem das Mahlwerk sich gleichmütig knirschend weiterwälzte. Draußen auf dem
Gestell umrundete der Schmied die Steine, zog eine Schiefertafel aus seiner Lederschürze und warf bedächtig eine
komplizierte Kreideskizze mit vielen Zahlen auf das schwarze Rechteck. Dann rauchten die beiden Steinbeschwörer Zigaretten,
lachten und nickten, gestikulierten und hatten sich, wie es schien, viel zu erzählen. Der Schmied erschien eine Woche lang
nicht. Der Schwarze pickelte aber weiter unverdrossen an seinen Steinen herum, rollte sie hin und her, rauchte und deckte
sie nach getaner Arbeit zu wie eine Mutter ihre Kinder. Ariane sah diesem ungewöhnlichen Treiben vom Küchenfenster aus zu
und wartete darauf, dass irgendwer zu ihr kommen würde um für irgendetwas, wovon sie nicht genau wusste, was es war, Geld
verlangte. Paul sah sich das steinerne Rätsel von der Galerie aus an, lächelte breit und hob verlegen die Schultern. Die
Mägde wussten genau, dass hier Verschiedenes im Busch war und konnten sich nur wundern über die Geduld der Chefin, die
sonst immer und überall hinterher war. Von wegen trödeln oder mal ein klein wenig einhalten. Immer wollte sie alle in
Bewegung sehen. Eben, bis auf den schwarzen Tiroler, und das war seltsam, also wirklich, das konnte einem nun keiner sagen,
dass daran nichts ungewöhnlich war. Eines Tages spannte der Schwarze ein Maultier vor den Wagen, verschwand in Richtung
Frenois und nicht lange, da erschien er wieder mit dem Schmied auf dem Kasten und vier metallenen Reifen auf dem Wagen. Nun
war folgendes zu sehen. Ein Reifen wurde aufgebockt. Dahinein setzte der Schwarze seine Steine in einer Art, wie andere ein
Kartenhaus bauen, mit Bedacht und größter Vorsicht. Am Reifen schloss der Schied eine Art Schnalle und ein Mühlstein war
fertig. Einen zweiten Reifen legten sie von oben an und schlossen auch den. Und so taten sie es auch im zweiten Teil ihrer
Montage, so dass am Ende sowohl ein Bodenstein als auch ein Läufer fix und fertig nebeneinander auf dem Gestell lagen. Nun
setzten sich der Schmied und der Tiroler auf ihre Steine. Sie schienen auf Verschworenheit hindeutende Gespräche zu führen.
Der Schmied holte in regelmäßigen Abständen einen Krug Wein nach dem andern aus dem Wagenkasten. Sie rauchten und tranken
und ihre Unterhaltung nahm an Dramatik zu. Als der Viertelmond ein wenig schief über der Mühlenhaube pendelte, sangen sie
mit den Hunden der Umgebung im Chor und auch die kräftigen Stimmen der Frösche drangen aus den fahlen Nebeln der
Niederungen mit hinzu. Paul schlief den Schlaf der Gerechten. Ariane seufzte zuerst und weinte danach noch ein bisschen. Am
nächsten Morgen sahen alle die Bescherung. Der Schmied schnarchte, bedeckt von seinem Lederschurz, riesenhaft hingestreckt
auf dem Wagen und die Enden seines Schnurrbartes wehten hin und her auf Sturm. Den Tiroler sah zunächst niemand. Er hatte
es sich zwischen den Steinen auf dem Holzgestell bequem gemacht und schlummerte im Schein der Morgensonne zusammengerollt
wie ein Kind bei seinen liebsten Spielzeugen. Es muss wohl der Anblick dieses hilfsbedürftigen Bündels gewesen sein. Von da
an, erklärten die Mägde unter sich, schimmerte in den Augen Arianes so ein Glanz, ja, so ein schwüles Brennen, so ein
gewisses unkeusches Glimmen. Entgegen ihrer Art sprach sie entweder mit dem Tiroler gar nicht, reichte ihm die Teller und
die Gegenstände nur zu, die sie für ihn bestimmt hatte, oder sie ging sanft auf seine Fragen ein, ohne ihn dabei anzusehen.
Es entstand der Eindruck, die beiden verstünden sich auch ohne Worte, einfach nur so, wie bei Gedankenübertragung. Eine der
Mägde hatte so etwas schon einmal in Reims auf dem Jahrmarkt gesehen. So etwas gab es also. Gewiss war da auch ein kleines
bisschen Hexerei mit im Spiel. Wer kann sich schon mit jemandem unterhalten oder einen andern verstehen, wenn der nicht mit
einem spricht, dazu, wenn es an vertrautem Umgang mangelt. Das ist unmöglich ohne eine teuflische Verschwörung der Seelen,
ja ja, sozusagen Unzucht mit dem Teufel. Gott bewahre, die Jungfrau Maria sei bei uns. Oder. Oder was. Na, vertrauter
Umgang. Vielleicht ist der Ungang ja doch nicht so unvertraut. Aha. Die Steine, so erläuterte der Tiroler später, waren,
von den Reifen gehalten, in sich stabil. Weil sie aber weder Zement noch Gips fest verbanden, blieben sie während des
Mahlvorgangs gegeneinander beweglich, so dass sie sich gegenseitig automatisch schärften. Diese Steine übertraf nur noch
der Diamant an Härte. Sie würden deshalb alle auf dem Hof der Mühle tätigen Lebewesen, ob Mensch oder Tier, überdauern.
Dank ihrer auf besondere Weise vergitterten Quarzadern, mahlten sie ein besonders feines und reines Mehl. Ein weiterer
Vorzug leitete sich aus dem konisch zu den Rändern hin abfallenden Mahlgang her, denn so lief glatt das Doppelte der
Kornmenge als bei herkömmlichen Steinen durch den Rüttler, was erstens mehr gemahlenes Korn bedeutete und zweitens weniger
Arbeitsaufwand. Als der Tiroler seine umständliche und hie und da auch ein wenig missverständliche Einführung in die
neueste Technik der Mühlsteine beendete - er sprach zum Beispiel davon, dass Korn für Korn, so zwischen den Steinen
zerrieben, zwar seiner Eigenschaft als Same entschlagen werde, dennoch dank der menschlichen Schöpferkraft, die sich in der
Technik Bahn breche in die nähesten und fernsten Räume, in neuer Gestalt einginge in das Wachstum anderer und deren Samen
bestärke, welches als ein Vorgang allerhöchsten Beispiels für Mensch und Erdkreis Bewunderung heische und als solcher auch
klar vor Augen führe, wie sich der Mensch zwischen dem, was er will und dem was von ihm gewollt wird, verwandle in eine
fast mythische Gestalt, die nur als gemeinsamer Menschheitskörper denkbar sei, dessen Weben und Streben füglich begleitet
würde vom aufopferungsvollen Streben und so weiter und so fort - nach dieser längeren Rede des Tirolers also, vorgebracht
in einem putzigen Französisch, durchwoben von einem altertümlichen Tirolerdeutsch, nickte der Schmied heftig mit dem Kopf
und sprach Amen, während die anderen nun erstmals erschüttert davon Kenntnis erhielten, dass dem Tiroler nicht nur eine
Schraube im Kopf zu locker saß. Allein Ariane blieb ernst und nachdenklich, wandte sich abrupt um, überquerte den Hof
eiligen Schrittes und verschwand in ihrer Küche. Die Mägde folgten ihr kopfschüttelnd und schnatternd. Die Gesellen
umrundeten ein ums andere Mal die Steine, fassten sie an, tätschelten sie wie Pferdeschultern und gaben ihre anerkennenden
Kommentare ab. Paul bestaunte die für seine Mühle bestimmten Wunderwerke auf seine Weise. Er setzte sich auf den Läufer,
befühlte ihn von seinem Platz aus, prüfte die Mitnehmer, nahm seine Mühle in den Blick, lehnte sich seitlich auf seinen
Ellenbogen zurück und strahlte arglos wie ein Honigkuchenpferd. Die Steine blieben zwei Wochen liegen, bis die Tagesarbeit
ein wenig nachließ. Dann zogen zwei Maultiere die Ungetüme auf Paletten, die sie mit dem Plattenwagen an den Mühlenaufzug
brachten. Hier knüpften die Knechte Seile an die Ecken und hoben die stabilen Holzböden samt ihrer wertvollen Last nach
oben, dass die Balken ächzten und knarrten. Die alten, zwar abgenutzten doch immerhin noch funktionsfähigen Sandsteine
gelangten über den umgekehrten Weg nach unten auf den Hof, wo sie die Männer mit vereinten Kräften aufrecht an die hintere
Mühlenwand lehnten. Keiner wusste, ob sie nicht doch noch einmal gebraucht werden würden. Nachdem die neuen Steine oben
aufgesetzt und justiert waren, gab Paul die Flügel frei und ein Geselle das Korn in den Trichter. Der Rüttler begann, das
Korn in den Mahlgang zu träufeln. Es knirschte ein wenig, es rieb hart, es gab ein kurzes Krachen und noch einmal ein
dumpfes Brechen. Dann fiel zuerst das Steinmehl heraus und ihm folgte der Kornbruch und aus dem Beuteltuch fiel das
blütenweiße Mehl in den Kasten, so fein wie Damenpuder. Die Gesellen standen und glotzten auf die Steine. Paul ließ das
Mehl durch seine Hände gleiten, beobachtete es aufmerksam, schnipste sich ein wenig auf die Zunge und legte gutgelaunt den
Kopf schief. Der Tiroler hockte oben, schaute gebannt auf seine Steine, registrierte jedes Geräusch, wie eine Katze auf dem
Sprung. Die Steine mahlten sich ein. Der Tiroler ließ sich von den Gesellen feiern. Stolz setzte er seinen abgewetzten Hut
in den Nacken, nahm einen Strohalm zwischen die Zähne und lud sie ein am Abend auf die leere Tribüne. Als die Sonne hinter
den Höhen von Donchery verschunden war, kam der Schmied mit einem Eselgespann. Und alle saßen auf hochgebockten
Holzplanken, prosteten sich zu, die Gesellen und die Mägde, der Tiroler und der Schmied und sogar Paul und Ariane. Am zwei
Latten hingen Petroleumlampen, die ganz ungewohnte Züge an den Gesichtern erkennen ließen. Der Schmied brachte aus einem
Holzkasten ein Akkordeon zum Vorschein, gab zuerst einen Galopp zum Besten und eine verunglückte Polka. Dann griff der
Tiroler in die Tasten und die Röcke flogen. Alle drehten sich bei Polka, Ländler und Ecossaise. Es war ein ausgelassener
Abend, selbst Paul und Ariane legten eine Carmagnole auf die Bretter, dass die Mägde zu schielen anfingen, denn der Wein in
den Bechern nahm nicht ab. Zwischendurch drückte der Schmied einen schwerblütigen Rheinländer aus dem Balg und der Tiroler
nutzte die Gelegenheit zu dem Versuch, gemächlichen Schwungs die Reihe der Mägde nach ihrer Hitze abzutasten. Das Manöver
war zwar sogleich durchschaut, doch dauerte es eine ganze Weile, bis die Rufe nach schnelleren Läufen so laut wurden, dass
sie dann auch sofort in die Tat umgesetzt werden mussten. Bei den flotteren Schritten verweis der Schmied augenzwinkernd
auf seine Fingerlähmung und überließ sich ganz der Beweglichkeit seiner Füße, indem er dem Tiroler das Instrument reichte
und bei den Mägden selbst Hand an Stellen legte, die, der beschwingten Gunst der Stunde folgend, sich in ungestümer
Bewegung verloren. Die Nacht umschloss das kleine Fest mit mildem Licht und samtener Wärme. Die Mühle stand als Riese da,
der über das launige Treiben mit abgeklärter Nachsicht wachte und seine Hände in Ruhestellung schützend über die Szene
breitete. Die Musik versiegte, als sich am östlichen Horizont ein heller Schimmer hob und die Mägde schweißgebadet und
außer Atem zu Gähnen begannen. Der Schmied streichelte Hände und der Tiroler gab noch ein paar Witze zum Besten. Dann
schirrte der Schmied seinen müden Esel ein und lud die Schar junger Frauen auf seinen Wagen, zuckelte über den Hof mit
ihnen und nahm zunächst den nach Südwesten führenden Weg durch den Wald von Marfee hinunter nach Cheveuges, wo die eine
Hälfte seiner Ladung zu Hause war und die andere nahm er, nordwärts einbiegend, über die Chausee mit nach Frenois. Paul
streckte sich, nachdem er seine Dusche genommen hatte, unter die Decke und wartete auf Ariane, die überrascht war und an
diesem Abend ihren Mann als über die Maßen schwer empfand. Sie sah während Paul hechelte und schließlich stöhnte unentwegt
hinauf zum Fenster, wo der schwache Morgenschein bläulich schimmerte. Der Tiroler leerte seinen Krug gemächlich auf seiner
Tribüne, die er wohl schon am heraufziehenden Tag sauber abreißen könnte, rauchte seine Zigarette zu Ende und begab sich
ein wenig benommen auf den Sackboden, wo er in einen Haufen leer herumliegender Rupfensäcke, die für die Kleie bestimmt
waren, fiel und, bevor er einschlief, lächelnd eine eher schwermütigere Melodie vor sich hinsummte. Der Stein bewährte sich
großartig, und mit eben diesen Worten wusste Paul allen, die ihn fragten oder nicht, von seiner neuesten Errungenschaft zu
schwärmen. Die Güte des Mehls fand allgemeines Lob und die Zahl der Mahlgäste nahm zu. Windlast und neue Steine forderten
den Arbeitseifer aller geradezu heraus. Dieser Umstand brachte es mit sich, dass Paul neben seinen kurzen Aufsichtsgängen
in der Mühle fast nur noch Mehl auslieferte. Die Kundschaft harrte seiner voller Erregung, er tat seine Dienste und zur
Nacht, in der rechtschaffenen Gewissheit, alles was in seinen Kräften stand getan zu haben, schlief er ein, noch bevor
Ariane ihren ersten Seufzer ins Kopfkissen hauchen konnte. Der Tiroler füllte das Korn ein, wartete das Lamellengerüst an
den Flügeln und reinigte alle Wellenlager, wie er sich überhaupt mit Inbrunst allen Teilen der Mühlentechnik widmete. Den
Mägden entging freilich nicht, dass er in letzter Zeit, nach dem kleinen Fest, eigentlich schon am folgenden Tag beim Abbau
des Gerüstes, verstärkt unter Durst litt und deshalb fortwährend in der Küche erschien mit der Bitte, ihm doch etwas zu
Trinken zu geben. Ariane mischte ihm sogleich schweigend ein Glas Wasser mit Ahornsirup, reichte es in seine Richtung ohne
ihn anzusehen. Er bedankte sich artig und trank im Stehen. Sein Blick fiel als ungewöhnlich auf. Das Hinreichen des Glases
wäre ja gar nicht nötig gewesen. Sie könnte es ja beispielsweise auch einfach auf dem Tisch stehen lassen und er nähme es
sich einfach weg. Aus den Augenwinkeln beobachteten die Mägde, dass dieses Überreichen eine Art Mitteilung zu sein schien.
Die Sache war klar, was gab es da zu deuten. Wer das Glas so hinhält damit derjenige, der es nimmt, es so nehmen kann wie
der Tiroler, na, der hat noch anderes zu geben als Wasser im Glas. Ach ja, das Leben ist ein Nehmen und ein Geben. Wie
sollte sie zurecht kommen mit einem, dem der Schwanz breiter ist als die Flügel. Oh ja, das war schon immer so, dass, wenn
der Schwanz steht, der Verstand im Arsch ist. Die beiden jungen Mägde zogen sich hochroten Kopfes zurück. Die anderen
blieben dabei und bestätigten sich ihre Lebenseinsicht mit immer neuen Sprüchen, so dass letztendlich herauskam, Ariane
soll sich mit ihren Gaben getrost wehren gegen Paul, diesen, na ja. Wildgänger, genau, der seine Kraft auf
Gelegenheitspirsch verpuffte, nur nicht dort, wo er sollte. Am Ende der Diskussion, die sich über Tage hinzog und immer
wieder angeknüpft wurde bei der Wasserglasfrage, waren sich alle Mägde einig, dass jeder Acker zu seiner Zeit bestellt
werden musste, im Frühjahr, ja, im Frühjahr. Mit einem gewissen Wohlwollen nahmen sie denn auch wahr, dass aus dem Tiroler
unter der Hand Francois geworden war oder Franz, so wie er ja eigentlich hieß. Oft überraschten sie die Chefin, wie sie in
Gedanken versunken am Fenster stand, in der einen Hand das Messer in der anderen das Gemüse. Erst beim Eintritt der Mägde
schreckte sie auf wie aus einem Traum und suchte dann um so eifriger, in überdeutlicher Hast, ihre Verlegenheit zu
unterdrücken. Die tiefbraunen Haare mit dem goldenen Schimmer versteckte sie nicht mehr so oft unter einer Haube, sondern
flocht sie zu einem lockeren französischen Scheitelzopf, den sie offen trug und der ihr bis zur Hüfte reichte. Das Fehlen
der Haube brachte die Gesellen in Verwirrung und steigerte den Durst des Tirolers ins Unermessliche. Außerdem geschah es,
dass er sich an einem Sonnabendvormittag hinab nach Frenois begab und sorgfältig rasiert und mit einem geschniegelten
Haarschnitt zum Mittagessen wieder erschien. Am Sonntag, auf dem Weg hinunter zur Kirche, trug Ariane eine Tüllstola überm
Haupt und das leichte dunkle Kleid aus Lyoner Tuch, während Franz seine schmucke Kombination angelegt hatte,
vervollständigt mit blank gewienerten Lederschuhen, einem eleganten Tirolerhut und jenem dezent ornamentierten Seidentuch
um den Hals, das den Mägden, außer seiner Erscheinung als ein Bild von einem Mann, zahlreiche Rätsel aufgab, weil sie so
etwas bisher nur bei den berühmten Chanson-Sängern auf den städtischen Jahrmärkten gesehen hatten und vermuteten, diese
modische Laune sei bestimmt ungeheuer kostspielig. Immerhin fand das ihre Billigung. Es konnte ja nicht irgendein
Lumpenheini dahergelaufen kommen und sich an ihre bildschöne Chefin heranmachen, auch wenn sozusagen Not am Manne war. Auf
ein fügliches Niveau wollten sie schon geachtet wissen. Wo käme die Menscheit sonst hin. Wohl war gleich zu sehen, dass der
Tiroler sich bemühte. Auch schien ein gewisser Geschmack offenbar, den er an den Tag legte. Da konnte sich eine Magd kaum
ihres Augenaufschlags erwehren. Nur Paul schien von alledem nichts mitzubekommen. Er taperte gespreizt an der Seite seiner
Frau dahin, ließ sein Mondgesicht zufrieden lächelnd nach allen Seiten strahlen und zog sich immerfort die viel zu enge
Hose aus dem Schritt und den knappen Frack aus den Achselhöhlen. Ein Wunder ohnehin, dass die Nähte diesem massigen Schwung
standzuhalten vermochten. Paul lebte in seiner Mühlenwelt und war von den zahlreich sich bietenden Anfechtungen zwischen
Douzy und Vringe aux Boix so gefangengenommen, dass er weder das sich Andeutende noch das Augenscheinliche wahrnahm. Die
Mühle stand selten still, denn auch an Sonntagen durfte, wenn das Korn nach der Ernte auf dem Schüttboden sich zu doppelter
Mannshöhe türmte, gemahlen werden. Die Gesellen wuchteten die Säcke vom Aufzug weg über eine Leiter auf die Stapel.
Windmüller standen, das wussten alle, in Gottes Hand. Sie konnten, anders als die Wassermüller, ihr Antriebselement nicht
selbst lenken und lebten und arbeiteten, vom Segen einer kleinen Schar Heiliger begleitet, in gewisser Weise nach eigenen
Regeln. Die andauernde Bewegung der Mühle und der in ihr tätigen Menschen führte von je her zu abenteuerlichen Geschichten
und Schreckensbildern, in denen Teufel und Wunder eine Rolle spielten. Aber auch der Müller und die Müllerin hatten sich
ihrer Haut zu erwehren, denn all die Märchen brannten ihnen das Zeichen auf die Stirn, dass sie ungerecht und betrügerisch,
mordlüstern und mit dem Teufel im Bunde wären. Mühlen galten dem wandernden Volk schon immer als Freistatt, hier gab es
wohlfeil Brot und ein trockenes Nachtlager. Und der Müllerin, so jedenfalls versorgten sich die großmäuligen Zugvögel
eigenermaßen mit selbstgewirktem Dünkel, kam jede Abwechslung gerade recht, ja. In schaurigen Flüstergeschichten
verfinsterte sich das Bild, wenn in der von Gespensterangst durchtränkten Phantasie die wilde Besitzgier der Müllersleute
in Raublust und Mord endete. Die zeitweiligen Tischgenossen gingen nach einem meuchlings erlittenen Tod selbstverständlich
ihrer im schmalen Mantelsack reichlich mitgeführten Schätze verlustig. Wandernde Müllergesellen blieben verdächtig, weil
ohnehin bekannt war, dass sie verwunschene Absichten hegten oder diabolische Fähigkeiten ins Spiel brachten. Entweder
verzauberten sie den Müller, weil er, der Eigensinnige und Misstrauische, ihre Hilfe ausschlug, oder sie bannten den Teufel
und behielten sich bis auf weiteres schlau den Widerruf vor. Sie trieben es ziemlich schlimm, diese umherziehenden
Müllergesellen, mit ihrem zweideutigen Sinnen und Trachten inmitten fremder Nester. Deshalb galt nur als gerecht, wenn sie
ihr Wappentier im Kuckuck zu erblicken hatten. Dieser unmoralische Vogel glich dem einen wie dem anderen, weil neben allen
nur denkbaren Charakterfehlern auch sein Federkleid eindeutig auf sie zu weisen schien, denn das Äußere des Vogels war auf
leidige Weise neblig und verwaschen, wie von Mehlstaub überzogen. Für einen wandernden Müllergesellen ist das Beste an
einer Mühle, dass die Säcke nicht reden können. Es wäre kaum auszudenken, welche Gestalt die Geheimnisse annähmen, wenn es
neben den Bauern, den sesshaften Gesellen und den Mägden auch noch andere Erzähltalente gäbe. Jede Maus, und in einer Mühle
treffen sich im Laufe der Zeit viele Mäuse, hat ihre besondere Geschichte. Jeder Tod, unter einem Schaufelblatt oder unterm
Schlagbügel einer Falle, kommt in den sich nachziehenden Erlebnisberichten der erfolgreichen Jäger einem Gespensterfeldzug
gleich. Es ist von jeher gang und gäbe, dass in kleinen und in großen Köpfen die Welt jene Gestalt annimmt, die sie sich
selbst aus Gleichmut nicht geben mag. Eine Mühlenwelt ist etwas ganz besonderes, immer fehlt etwas, immer ist etwas in
Bewegung, immer bringt das Hoffen auf die Gunst der Stunde die unterschiedlichsten Wunschbilder hervor, die in allgemeine
Harmonie gebettet sind. Je schlimmer die wirklichen Verhältnisse sind, um so deutlicher, mitunter sogar schroffer, müssen
die aus ihnen erwachsenden Träumereien sein, damit sie geeignet sind, den Drang nach persönlicher Harmonie zu erfüllen.
Dies gebietet allein schon die Eigenliebe eines jeden, ja, es ist dies eine der springenden Voraussetzungen dafür, wie er
sich auf seine, ganz besondere Weise im Mittelpunkt einer selbstgebauten, fein abgewogenen Welt einzurichten versteht. Dem
Tiroler ging so dies und jenes durch den Kopf. Die Gedanken waren frei, wenn er sich dem Mahlgang widmete oder wenn er
still und geduldig die Mitnehmer am Treibrad auswechselte oder die Flügellamellen kontrollierte und ersetzte. Sein Gesicht
versank in ernster Starre. Dann wagte kaum jemand mit ihm zu sprechen, denn der kühle Grimm waltete um ihn und schaffte
einen stillen Bannkreis. Wagte dennoch jemand eine Frage, brummte er nur unwillig etwas Abweisendes zurück. Wenn er
arbeitete, dann arbeitete er auch, wenn er feierte, dann feierte er bis zu Erschöpfung. Der Tiroler Franz, der Schwarze,
das war schon ein eigenartiger Mensch, ja. Aber Paul ließ nichts über ihn kommen. Dem brauchte keiner zu sagen, was gerade
anlag. Das wusste der von ganz allein und die Mühle lief wie geschmiert. Mit den neuen Steinen sowieso. Und Paul konnte
sich bei seinen Auslieferungstouren ruhig Zeit nehmen, denn war der Schwarze da, musste man sich keine Sorgen machen.
Wenngleich in den Windmühlen auch an Sonntagen und Feiertagen das Mehl durch die Rütteltücher fiel, so durften dennoch die
Mahlgäste an diesen Kirchtagen kein Korn abgeben und Paul lieferte auch nicht aus. Wer all das Verbotene trotzdem tat, nahm
in Kauf, dass die Gegend vom Hagel heimgesucht würde. Diesem Vorwurf wollte sich keiner aussetzen, auch Paul nicht.
Überdies saßen an den Tagen des Herrn die Ehemänner gebieterisch und pünktlich an den Tischen und die Routine der
Hausfrauen folgte anderen Gesetzen als an den Wochentagen, wenn sie, den Wonnen ihres Lebens ganz und gar verfallen, Paul
an jenen geheimen Stellen zu forschen erlaubten, deren Berührung ihre Schmetterlingsherzen frei flügeln ließ und so die
trübe Last ihres alltäglichen Einerleis minderte. Die Feiertage der Windmüller lagen übers Jahr verstreut, wenige vor und
die meisten nach dem Hauptgeschäft der Erntedurchgänge. Am 18. Juli, dem Tag des Heiligen Arnulf, stand die Mühle still,
genau so wie am Wetterlostag, dem 1. September, zum Gedenken an die heilige Verena. Außerdem ruhten die Flügel am Sonntag
vor Pfingsten, an den Weihnachtstagen und in den zwölf Nächten. Je nach Lage der Dinge zogen auch die Heiligen Franz am 4.
Oktober, Martin am 11. November, Katharina am 25. November und Nikolaus am 6. Dezember die inbrünstige Verehrung der Müller
auf sich. Diese auf Votivtafeln immer anwesenden Leidenshelden duldeten aber immerhin den Lauf des Mahlwerks, wenn die
Umstände eine ansehnliche Ladung Korn und guten Wind zusammenbrachten. Ihr Verzeihen hatte gute Gründe, denn war nicht der
HERR selbst der größte Müller den sich der Mensch in seiner schwachen Vorstellungskraft nur annähernd in seiner ganzen
Bedeutung vor Augen zu führen vermochte. Paul war davon überzeugt und er fühlte sich von dieser Berufsverwandtschaft von
vornherein bestätigt, wenn nicht sogar ein wenig erhoben. War nicht die ganze Welt Gottes große Mühle, in der er all das,
was er am Anfang gleichsam zwischen Himmel und Erde geschaffen hatte, nach seinem Befinden zu Staub zerrieb. Doch bohrte in
Paul eine letzte Ungewissheit, eine grundlegende Frage, die er immer und immer wieder bei sich wälzte und auch in passenden
Augenblicken ansprach, ohne eine abschließende Bestätigung, dafür aber auch ohne nennenswerte Beeinträchtigung seines
Wohlbefindens. Schon von Kindesbeinen an verfolgte ihn dieses gedankliche Unbehagen. Der Großvater führte einst seinen
kleinen Enkel Paolino mit nach Reims. In der gewaltigen Kathedrale schleuderte der gestrenge Erzbischof mächtige Worte von
der Kanzel herab, mitten in den vor Staunen benommenen Kopf des Jungen. Daher kam wenig später das Gefühl, seine
Schädeldecke sei nach dem Durchschreiten des mittleren Westportals, als er sich noch einmal überwältigt umwandte und über
dem Eingang in die blauen, gelben, roten, grünen Strahlen des im warmen Schein der abendlichen Sonne hell aufleuchtenden
Katharinenrades sah, jählings aufgesprungen. Das ornamentale Gleichmaß dieser Farben füllte ihm die Augen bis zum Rande an,
bis er sie zu hören meinte, er ein alles erfüllender Akkord schwoll in seinen Ohren an, ein Klang, der ihm alles zu
umfassen schien, die Welt, sein Herz, den Großvater, die Mühle und den Wind, alles schon Gedachte und alles, was er noch
denken und sein konnte. Paul hatte beim ersten Betreten der Kathedrale Gott erfahren. Der Schöpfer, nur so konnte er sich
das später, viel später, als er beim gleichmütigen Einfüllen des Korns in den Mahlgang daran zurückdachte, erklären, hatte
ihm alle Sinne geöffnet, um ihm zuzurufen, dass auch er, Paul, Kind Gottes, wie seine Väter ein Müller sein werde gleich
IHM, denn dies sei seine Bestimmung. Es war also in gewisser Weise eine Berufung, die noch in der Kathedrale durch drei
weitere einschneidende Erlebnisse ihre Bestätigung fand. An der Hand des Großvaters schwebte Paolino noch ganz benommen
durch das Mittelschiff und gewahrte erst im Stehen das ganze Ausmaß seines Staunens vor dem Welttheater des
Christusportals. Im Bogenfeld dieser steinernen Himmelstür saß ganz oben der Herr und alle die vielen Gestalten, die selbst
Großvater nicht alle erklären konnte, waren ihm zugeneigt, sie gehörten ihm an, und das wollte Paul auch, er sah sich in
Abraham, dem sich vier Engel in gebeugter Haltung respektvoll zuwenden. Hinter ihnen stehen die verstorbenen Seelen, von
Engeln, die ihre Hände führen, begleitet. Ja, bevor Paul auf den Stuhl Abrahams Platz nehmen konnte, war es ihm aufgegeben,
sich diese Würde anzueignen, als jemand, vor dem sich die Nahenden in Zuneigung beugten. Doch vorerst hielt er seine Hand
in der des Großvaters geborgen, wie die der Seligen bei den Engeln und es schien ihm, als lege er Vorheriges ab, als sei er
jetzt ein anderer, ein junger Abraham etwa. Doch was das bedeutete, erschloss sich ihm erst viele Jahre danach, als ihm die
Hand des Großvaters von den Engeln schon entwunden worden war und die Anfechtungen des Lebens ihn zwangen, seine ganze
Aufmerksamkeit darauf zu richten, wenigstens ein Seliger zu werden, der sich an der Hand eines Engels zur Rechenschaft
gebeugt einst dem Stammvater anvertrauen darf. Wenigstens dieses. Mit aufgerissenen Augen und klaffendem Mund folgte Paul
dem Großvater, der ihn sanft ins himmelweit aufstrebende Schiff der Kathedrale zurückzog. Sie setzten sich in eine Bank,
die wie alles andere Gestühl bereits von betenden Gläubigen belegt war. Gesang, Musik und die vielgliedrige Umgebung, die
gar nicht steinern wirkte sondern leicht und hinanführend, erfüllten Paul so sehr, dass er sich selbst zu Holz erstarrt
fand. Dann schwenkte der Bischof sein Becken und es folgte das zweite Erlebnis, das ihn aus seiner überwältigenden
Verwandlung riss und ihm wiederum das Gefühl gab, sein Kopf sei weit geöffnet, so dass der donnernde Redefluss des
Kirchenmannes hineinfallen und sich fest einpuppen konnte, auf dass diesen Worten die Anregung zu jener heilsamen Einsicht
entspringen konnte, deren Paul in seinen Leben je nach dem Hergang der Dinge bedurfte. Gleich aber wie es zu der zeit Noe
war, also wird auch sein die zukunfft des menschen Sons, Denn gleich wie sie waren jnn den tagen vor der sindflut, sie
assen, sie truncken, freieten, und liessen sich freien, bis an den tag, da Noe zu der archen eingieng, Und sie achtens
nicht, bis die sindflut kam, und nam sie alle dahin. Also wird auch sein die zukunfft des menschen Sons, Denn werden zween
auff dem felde sein, einer wird angenomen, und der ander wird verlassen werden, Zwo werden malen auf der müle, eine wird
angenomen, und die ander wird verlassen werden. Darumb wachet, denn jr wisset nicht, welche stunde ewer Herr komen wird.
Das solt jr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, welche stunde der dieb komen wolt, so würde er ia wachen, und nicht jnn
sein haus brechen lassen. Darumb seid jr auch bereit, denn des menschen Son wird komen zu einer stunde, da jr nicht meinet.
Welcher ist aber nu ein trewer und kluger knecht, den der herr gesetzt hat uber sein gesinde, das er jnen zu rechter zeit
speise gebe? Selig ist der knecht, wenn sein herr kompt, und findet jn also thun, Warlich ich sage euch, er wird jn uber
alle seine güter setzen, So aber jhener, der böse knecht, wird jnn seinem hertzen sagen, Mein herr kompt noch lange nicht,
und fehet an zu schlahen seine mitknecht, isset und trincket mit den trunckenen, So wird der herr des selben knechts komen,
an dem tage des er sich nicht versihet, und zu der stunde, die er nicht meinet, und wird jn zuscheitern, und wird jm seinen
lohn geben, mit den Heuchlern, da wird sein heulen und zeenklappern. Die grundlegende Frage war von diesem Zeitpunkt an, ob
Paul, der die Ankunft des Herrn mit jedem Augenblick, in dem er an ihn dachte, erwartete, ein guter oder ein böser Knecht
war. Er aß gut, aber nicht üppig, er trank gern, aber nicht im Übermaß, er schlug nicht sein Gesinde. Und doch, einerseits,
wie war das mit den Frauen, kam er nicht als Dieb zum braven Hausvater, andererseits, im Grunde stahl er ja nichts, im
Gegenteil. Außerdem, wenn der Herr wollte, dass er den Frauen nichts antue, würde er ja die Hausväter wachen lassen über
ihre Weiber. So kam Paul zu dem Schluss, dass er in gewisser Weise auch dem Menschensohn glich, der zu einer Stunde kam,
die keiner erwartete und Gutes tat. Aber, wer konnte sich schon sicher sein, bei so vielen sich widersprechenden
Gleichnissen und Anweisungen, besonders hinsichtlich ehebrecherischer Vorgänge, denen bei ihm nun allerdings eine
Besonderheit anhaftete, nämlich, ohne Ansprüche zu sein. Ihm würde nie einfallen, die alleinige Hoheit über die
Venusregionen seiner Begünstigten zu pochen. Es war auch keine Liebe im Spiel. Im Grunde lebte Paul in einer Saturnalie in
Permanenz, doch auch diese heidnische Erklärung seiner Dienstleistung konnte er nicht recht fassen und so beließ er es bei
ihrer praktischen Ausübung, (skeptisch) untergraben von dem stillen Leidenstriumph, dass alles Gute auch immer ein
Quäntchen Schlechtes bei sich trage. Das dritte Erlebnis schlug ihn beim Verlassen der Kathedrale in ihren Bann. Noch
einmal schaute er zum Katharinenrad hinauf, diesem mächtigen Rosettenfenster, das ihm wie ein Weltwunder vorkam. Dann
durchschritt er das Portal, wandte den Kopf zurück und blieb wie gelähmt stehen, so dass der Großvater ihn beinahe
umgerissen hätte, während die anderen, die aus der Kathedrale strömten, ihn anstießen. In der Heimsuchungsgruppe sah er
das, was ihn am meisten erschütterte, nämlich seine Mutter in Stein. Der Großvater dachte, ihm wäre nicht gut. Sie
warteten, bis das Portal sich schloss und die Besucher des Gottesdienstes sich verlaufen hatten. Dann hob Paul seinen Arm
hinauf und bedeutete dem alten Mann, dass dies seine Mutter sei, und wie sie wohl hierher komme. Der Großvater lächelte ein
wenig, strich ihm über den Kopf und brummte etwas wie, ja, ja, so schön sei sie wohl gewesen, seine Mutter. Mit der Zeit
war die Maria vom Westportal mehr und mehr zum Abbild seiner Mutter geworden, denn immer, wenn er auf dem Friedhof an ihr
Grab trat, hatte er mit fortschreitender Zeit nicht mehr seine Erinnerung an die lebhafte junge Frau vor Augen, die mit
einer groben Schürze bekleidet wie ein Wirbelwind über den Mühlenhof rannte und sich seinem Vater wild an den Hals warf,
als er einmal für längere Zeit abwesend war, sondern jene biegsame Frau in Stein, die zuhörte und zugleich mitteilte und
deren natürliches Selbstbewusstsein so nachdrücklich auf ihn eindrang, weil es auf mütterliche Weise jenes Verzeihen
ankündigte, dessen er so stark bedurfte. Das Gesicht seiner Mutter war festgehalten in einer Schar ähnlicher Gestalten, die
in Gebärden zu sprechen schienen. Sie teilten ihm überwältigende Botschaften mit, die er aufnahm als große und
allumfassende Weisungen, von denen nun sein Leben abhing. Sein ins Weite gespannte Gefühl gab ihm die Gewissheit, dass er
hier nun in einer ewig fortbestehenden Familie aufgehoben war. Sein Tun und Trachten, so erkannte Paul im Rückblick nach
Jahren, würde dank dieses Erlebnisses zu keiner Zeit mehr anfechtbar sein. Nichts konnte sich sich ereignen, von dem er
sich heimgesucht wähnen konnte. Es war ihm aufgegeben, zu handeln nach dem Gebot seiner Erleuchtung. Selbstverständlich
verbarg er das, was ihm bei dem Besuch der Kathedrale von Reims widerfahren war, tief in seiner Brust. Doch ihm wuchs
daraus mit den Jahren eine innere Stärke zu, eine Freiheit, die ihn all das erlangen ließ, was er sich vornahm. Mochten
andere seine stille, nach innen gekehrte Art, die sich stets in Freundlichkeit und Teilnahme äußerte, gern als Einfalt oder
Kopfschwäche nehmen. Insgeheim pflegte und vervollständigte er diese ihm wie eine zweite Haut gediehene Fassade um so
sorgsamer, je mehr Grund er hatte, an der hinlänglichen Fortdauer seiner Erleuchtung zu zweifeln. Das galt für manche
sündhafte Gedanken und Taten, die er für lässlich hielt und die im göttlichen Zwiegespräch durch Einsicht und Beteuerung
einigermaßen zu rechtfertigen waren. Da hinein schloss er auch seinen Anteil am Ehebruch, denn von ihm aus gesehen war das
zwar Sünde, aber, zu diesem Schluss war er endlich gekommen, als er seine leidenschaftliche Frauenlust auch vor Gott nicht
mehr bändigen konnte, ohne Schaden für niemanden und deshalb ohne Schuld. Doch das Problem hatte zwei Schneiden. Über die
eine, seine Sündhaftigkeit, war er sich im Klaren, damit konnte er alt werden, dieses Risiko trug er als Bürde seines
Lebens. Freilich war da noch die andere Schneide, angesichts derer sich Paul nicht recht schlüssig werden konnte, inwieweit
er seine eigene ehebrecherische Anfälligkeit auch bei seiner Frau in Rechnung stellen durfte. Zwar war er zu hundert
Prozent überzeugt, dass Ariane ihm die eheliche Treue hielt, denn sie war ihm eine gute Frau. Doch saß der Stachel der
Ungewissheit fester in seiner Seele als der angenehm linde Balsam absoluter Sicherheit. Bei den umfangreichen Überlegungen,
welche Schäden er geltend zu machen hätte, wenn Ariane auf ähnliche Weise ihre körperlichen Vorzüge in den Dienst einer
allgemeinen Zufriedenheit stellte, war ihm noch nichts Einleuchtendes beigefallen. Zwar wünschte er sich Ariane gegenüber
eine Schlussfolgerung, die er selbst in solchem Falle einem der betroffenen Ehemänner antworten würde, nämlich mit dem
Hinweis auf nichts. Doch dieses Nichts war sein Nichts, von dem er wusste, dass es nichts war. Hingegen konnte er aber
keineswegs sicher sein, dass diese seine Gewissheit sich selbst gegenüber auch auf Ariane zutreffen würde. Im Übrigen, war
er nicht eigentlich im tieferen Sinn, dem des Lebens im Allgemeinen nämlich, Ariane gegenüber im Recht. Gut, sie war zwar
ein ansehnliches Weib und über ihren Fleiß hatte er nur gute Worte. Sie hielt ihren Teil der Mühle fest in der Hand. Bei
genauerem Hinsehen jedoch, naja, in gewisser Weise fand er sie ein wenig unhandlich, zu überlegt und auch ein bisschen
hölzern. Das hatte er ja nicht wissen können, als der alte Clerambault mit ihm handelseinig geworden war. Außerdem, sie war
ja wirklich ein Bild von einem Weib. Aber, die Frauen in den Dörfern waren eben anders. Sie wanden sich griffig unter
seinen Händen, rafften ihre Röcke mit jener Leidenschaft, deren ans Schreien gemahnende Seufzer ihn so fesselte. Diese
stabilen, vor erregter Wollust zitternden Frauen litten niemals unter schlechtem Gewissen. Sie teilten ihm, die Röcke
kokett herabstreichend, unumwunden mit, wann er wieder zu ihnen kommen dürfe und gaben ihm jene genau bemessene Menge Korn
mit, die bis zu diesem Termin gemahlen sein muss, auf dass er wiederum Mehl und Kleie pünktlich liefere. Im Blick der
Bäuerinnen lag beim Abschied immer etwas von dieser nach innen gewandten Andacht, die Paul so bewundernswert empfand. Sie
waren klug genug zu wissen, dass der stille Paul nicht an der verbreiteten Männerkrankheit litt, die ihnen in der
Vergangenheit nur allzu oft das Leben zur Hölle gemacht hatte. Wenn es schon einmal vorgekommen war in der Hitze der Ernte
oder im verschwiegenen Scheunenwinkel, eilten die Kerle nach jedem Sprung gleich lauthals auf den Dorfplatz und berichteten
allen und jedem von ihren schmächtigen Heldentaten. Da konnten sie auch gleich ihre Ehemänner ertragen. Doch bei Paul war
das anders. Er gab ihnen Wärme und den Frieden der Seele, er wusste mit Frauen umzugehen ohne zu reden. Er sprach mit
seinen Händen und all dem Drum und Dran. Bei ihm hatten sie das Gefühl, er widmete sich ihnen, um sie glücklich zu machen
und nicht, um sich selbst nur schnell abzureiben. Ein weiterer Vorteil war, dass Paul bei den Bauern allgemein für ein
bisschen schwachköpfig galt. Damit honorierten sie die ruhige, zurückhaltende Art seines Umgangs und die Unfähigkeit, seine
Mahlgäste zu betrügen. Noch niemals hatte jemand Grund zur Beschwerde wegen Übervorteilung. Das Verhältnis des Korns zu
anteilig Mehl und Kleie war immer peinlich genau und korrekt. Das Mahlgut war niemals feucht. Es hatte auch noch niemand
Steine oder andere vergessene Metall- oder Holzteile in den Säcken gefunden. Sie hatten das Mehl schon zur Genüge durch
ihre von Kesten und Schwielen wuchtig gewordenen Hände rinnen lassen. Sie hatten gemeinsam auf die Anzeigen der genauesten
Waagen gestarrt. Nichts. Einen solchen Müller, der nicht im Geringsten Grund zu einer Herausforderung im Gewichtsstreit
bot, konnten die schlitzohrigen Bauern nicht ernst nehmen. Zumal sie beim Zutragen des Korns schon alles versucht hatten
mit Steinen und allerlei schwerem Schrott unter dem Korn in den Säcken. Aber alle nahmen enttäuscht von solchen Versuchen
Abstand, weil Paul einfach darüber hinwegging und sie durch sein gleichmütiges Nichtbeachten kränkte. Der Müller ließ sich
auch vom schlimmsten Spelzendreck ihres tauben Korns nicht aus der Ruhe bringen. Dass es da ein Geheimnis gab, war allen
offenbar. Doch wo es lag und aus welchen Umständen Paul seinen ganz eigenen Triumph zog, blieb ihnen nach wie vor ein Buch
mit sieben Siegeln. Allein der noch junge Confessarius von Frenois musste während der Beichten mit anwachsendem Erstaunen
gewahren, dass des Müllers Fleiß sich auch bevölkerungspolitisch niederschlug, beispielsweise im Taufregister. Als der
Geistliche über die Jahre hin seine Gedächtnisfrische überfordert sah beim Zusammenhalten sowohl der offenen als auch der
verborgenen familiären Linien, beschloss er, weislich vorausschauend, eine geheime Verwandtschaftsmatrikel für seinen
Sprengel anzulegen. So würde er in nicht allzu ferner Zukunft gegebenenfalls jenen verderbnisheischenden Irritationen
vorbeugend entgegentreten können, die aus dem Zuwendungsüberfluss des Müllers zweifellos erwuchsen. Auch nahm er sich vor,
ein ernstes, ein sehr ernstes Wort mit dem Müller zu reden, denn er sah bitteres Blut voraus, wenn die Gesichter des noch
minorennen Nachwuchses, Gott sei es geklagt, einstmals ihre wahren genealogischen Wurzeln entblößten. Es blieb wohl dem
Allmächtigen nicht verborgen, wenn seine Geschöpfe ihren Samen wahllos verstreuten. Ob er das allerdings guthieß, auch wenn
daraus gute Katholiken reiften, war mehr als fraglich. Sprach nicht Markus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein
Mensch Samen aufs Land wirft, und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst - er weiß nicht
wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn
sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da. Das war bedenkenswert, denn
kurz ist das Erdenwallen eines jeden Schafes in der Herde des Herrn und ein heutiger Nachteil konnte schon morgen ein
großer Vorzug sein. Zwar gab auch wohl Gott durch Mose das steinerne Gebot, die Ehe nicht zu brechen, doch wollte der
Confessarius nun auch nicht mit Gewalt darauf dringen, dass der Müller ganz und gar zum Barfüßer werde. In gewisser Weise
konnte der Diener Gottes in Frenois das Müllertreiben sogar als füglich anerkennen, wenn er den Begriff der Schwagerehe in
seine monologische Disputation einbezog. Mit einem Blick über den ungeordneten Bücherstapel zum leidenden Christus und mit
einem anderen am Schirm der Schreibtischlampe vorbei zur mütterlichen Jungfrau erhellte sich ihm in seinem Studiergehäuse
das biblische Gleichnis allmählich zur Gewissheit, dass sich in Anschauung der ihm widerfahrenden Ordnungspflichten aus der
göttlichen Betrachtung dieses speziellen Schöpfungsgeschehens ein höherer ekklesiastischer Auftrag ableiten ließ, nach dem
er in aller Pflichtstrenge zur Ehre Gottes zu handeln und Anteil zu nehmen hatte - einem höchsten Auftrage mithin, dem er
sich bei Strafe aller Höllenqualen nicht entziehen durfte. Auf den Umschlag schrieb er mit Bedacht: Quod lucem Satane
tribuas est sepe necesse, was ihm hieß, dass es unumgänglich war, dem Teufel zwei Kerzen anzuzünden, damit er uns in
Frieden lasse. Er musste mit dem Müller ein gottgefälliges Gespräch führen. Und im Übrigen seine Kinderkladde ordentlich
auf dem Laufenden halten. Das Kirchweihfest in Frenios fiel immer auf das Wochenende nach dem 4. Oktober, dem Tag des
Heiligen Franz. Bis dahin war die Ernte eingefahren, das Korn trocknete ausgebreitet und täglich gewendet auf den Söllern
und als letzte Bodenfrucht brachten einige wenige Bauern die Kartoffeln unter Dach und Fach. Die Kirchweihe nahmen alle als
festlich ausgelassenes Verschnaufen, bevor die Herbstfurche gezogen und der Wein gelesen wurde. Es gab also auch bis zum
Andreastag am 30. November noch viel zu tun. Spätestens dann erwarteten sie in der Mühle auch das erste trockene Getreide
aus der Jahresernte, aus dessen Mehl die Frauen nach Sitte und Brauch das Weihnachtsbackwerk zubereiteten. Für die
Prozession zu Ehren des heiligen Franziskus gab es in Mühle und Hof umfangreiche Vorkehrungen zu treffen, nicht nur was die
Wirtschaft betraf, sondern auch persönliche Dinge. So waren nicht nur Werkzeuge, also Sägen, Äxte, Nadeln und
Drechslerutensilien, sondern auch Zubehör wie Nägel, Scheuermittel, Sackgarn und Schnüre zu besorgen. Der eine Geselle
brauchte neue Schuhe, der andere eine Hose, der dritte war versessen auf eine Taschenuhr, diese Magd wünschte sich ein
neues Kopf- oder Halstuch, die andere hatte auf Ohrringe gespart und jene verlangte nach einem Ballen feinen weißen
Leinentuchs oder sogar nach Batist und dem entsprechenden Handarbeitsmaterial, um sich daraus ihre Aussteuer nähen zu
können. Ariane nahm ihren Bleistift vom Gewürzbord, wo er stets für Notizen zur Hand lag, und schrieb die Bestellungen
sauber in steilen Buchstaben untereinander auf einen großen Zettel. In der letzten Septemberwoche dann beauftragte Paul den
Tiroler, mit Ariane nach Sedan zu fahren, um das Nötige für das bevorstehende Fest zu beschaffen. Am Donnerstag, dem
Markttag, sollte der Schwarze in aller Frühe anspannen. Am Mittwoch schien es noch, als müsste Franz mit einer Magd nach
Sedan fahren. Denn nach Pauls Entscheidung, seine Frau solle für die Tour zum Markt den Tiroler mitnehmen, fiel Ariane
augenblicklich in eine seltsame Unpässlichkeit. Bleich und fahrig schlich sie von einer Ecke der Küche in die andere,
wischte sich die Schweißperlen von der Oberlippe und setzte sich alle Augenblicke seufzend auf einen Schemel oder einen
Stuhl, so, als wäre sie gar nicht da. Sie bewegte sich wie im Fieber und es schien, als verlören sich ihre Gedanken in
einer anderen Welt. Leblos starrte sie mal hierhin, mal dorthin. Von der Pumpe kam sie ohne Wasser zurück und die Suppe
wäre angebrannt, hätte nicht eine junge Magd geistesgegenwärtig den Kessel vom Feuer gezogen. Am Mittwochabend stand ihr
das schweißnasse Haar in Strähnen wirr vom Kopf ab. Am Morgen stand sie mit bleiern getönten Augenringen am Ofen, schon im
Stadtkleid, mit umgebundener Schürze. Der Zettel lag auf dem Tisch, die Geldbörse dabei und die lederne Handtasche. Nach
dem Frühstück gab sie mit kaum hörbarer Stimme einer Magd Anweisungen für das Melken der Kühe, das Saubermachen, das
Mittagessen und das Einholen der Wäsche. Sie werde sich beeilen und spätestens zur Vesperzeit wieder zurück sein, damit das
Vieh in Ruhe zu Abend gefüttert werde und sie die Tageswäsche einweichen könne. Draußen saß der Tiroler bereits auf dem
Wagenkasten. Die Maultiere glänzten in der schrägen Morgensonne wie edle Rassepferde. Sie standen geduldig und drehten ihre
Ohren. Ariane knüpfte die Schürze ab, legte sich ein Tuch über das vom Hinterkopf herab geflochtene Haar, steckte langsam
Zettel und Geldbörse in ihre Reisetasche und ging endlich unsicher über den Hof hin zum Wagen. Der Tiroler schwang sich
herab und sie ließ es zu, dass er ihr auf den Kasten half. Dann ging er zu den Maultieren, kraulte sie an den Ohren und an
den Unterlippen, murmelte dabei unverständlich herum, nahm die Zügel, löste die Bremse und schmatzte mit den Lippen. Die
Tiere gehorchten sofort, zogen an und der Schwarze lief, die Zügel schürzend, neben dem Wagen her vom Hof. An der Wegneige
hinunter ins Tal drehte er an der Bremskurbel und dann waren sie verschwunden. Ariane saß bewegungslos und ertrug das
Rütteln mit starrer Miene. Der Tiroler lächelte zu ihr hinauf. Er bot ihr einen kleinen Futtersack an, auf den sie sich
setzen könne, es wäre dann auf die Dauer nicht zu hart. Sie errötete, nahm aber den Sack, raffte die Glocke des Kleides an
ihren Knien und schob sich die Polsterung unter. Dann setzte sie sich vorsichtig wieder. Er lachte sie an, zeigte seine
Zähne, schob dabei seine Mütze in den Nacken, verdrehte die Augen als wollte er sagen, dass dieser Teil besser weich
gelagert sei. Sie blickte auf sein Lachen. Dann in seine Augen. Diese ganze Art kam ihr so lausbübisch vor, dass sie
unweigerlich auch zu lachen anfing. Er fragte sie so nebenbei, ob sie alles dabei habe, was sie brauche. Bestellung, Geld
und so weiter. Sie sah ihn verdutzt an. Da wurde er sich bewusst, dass seine Frage eine eher peinliche Frechheit an sich
hatte. Er schlug die Augen nieder, rückte seine Mütze nach vorn und bückte sich verlegen nach einem Halm. Als er aufsah,
lächelte sie ihn an. Leicht tippte sie mit ihrer linken Hand auf den Platz neben sich. Er ging schnell um die Maultiere
herum. Die hatten im gebremsten Gang mit der Wegneigung und dem schiebenden Wagen zu tun. Trotzdem tat er so, als sehe er
nach dem Rechten, fummelte an der Bremsleier herum, klopfte mit dem Fuß aufs Bremsscheit und rüttelte an der Leuchse.
Nachdem er alles genauestens kontrolliert hatte, stieg er auf den Kasten neben Ariane. Umständlich verknüpfte er die Zügel
mit einem Knoten an der Kurbel. Im Vorbeugen, als er seine Ellenbogen auf die Knie stellte, sah er ihre Beine und die Füße
in den Schuhen mit Schnalle. Mit einem Ruck setzte er sich kerzengerade auf, holte sein Rauchzeug heraus. Sie schaute ihm
von der Seite her zu. Was wohl der Unterschied zwischen Pfeife, Zigarre und Zigarette wäre. Rauch umwallte sie beide. Naja,
Pfeife ist Pfeife und Zigarre eben Zigarre. Zigarette ist eben einfacher, schneller und billiger. Beim Unterschied kommt es
eben auf den Geschmack an. Ein Russe habe ihm das Zigarettenrauchen schmackhaft gemacht, drüben in Holland. Die Russen,
aha, die rauchten also auch Zigaretten. Jaja, nickte er, sie machen alles genau so wie andere Menschen auch. Wieder schaute
sie ihn lächelnd an. Wieder merkte er zu spät, was los war. Es war nicht seine Art, durch die Blume frech oder anzüglich zu
sein.
...
|
|
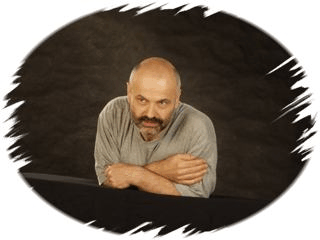 |
|