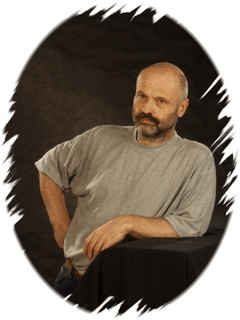Kritik
|
Theater: 165 Jahre auf Heinrichs Spur
|
Albert R. Pasch inszenierte in Meiningen Faust, der Tragödie zweiter Teil
von Johann Wolfgang von Goethe
Faust, der Tragödie zweiter Teil auf das Theater zu bringen ist für jeden
Regisseur ein Entschluss mit weitreichenden Folgen. Albert R. Pasch hat sich
dieser schier beängstigenden Anhäufung sehr ernster Scherze (Goethe)
gestellt und sich damit selbst ein Abschiedsgeschenk dargereicht. Denn das
ist es auch aus der Sicht der Theaterleitung: Der Aufwand für die
Inszenierung des letzten Goethe-Werks übertrifft den für manch anderes Stück
nötigen um ein Vielfaches. Albert R. Pasch also, der langgediente
Schauspieldirektor von altem - familiäre Vorbelastung bewußt
einkalkulierendem - komödiantischem Schrot und Korn, scheidet von der
Meininger Bühne. Intendant Ulrich Burkhardt ließ es sich denn auch nicht
nehmen, den Rahmen der Premierenveranstaltung im Nachhinein für eine
Belegschaftsversammlung nutzend, einige Lebensstationen des von der
Zuneigung seines Publikums ehrlich berührten Schauspieldirektors Revue und
ebensoviele würdigende Worte passieren zu lassen. Der Angesprochene war
darob scheinbar gerührt; wer sich in Theaterkantinen und den nach ihnen
genannten Gesprächen auskennt, mag wissen, wie sehr.
Mit Albert R. Pasch verlässt ein solider Regie-Routinier das Meininger
Ensemble, ein glänzender Darsteller und ein gewiefter Organisator, der mit
seiner Arbeit ganz gewiss zu den Stützen des Hauses zählte. Seine Fans
dürfen hoffen, dass der beliebte Komödiant schon von Natur aus der
werrastädtischen Theaterluft nicht von heute auf morgen abrupt entraten kann
und sozusagen von außen auch fürderhin das Repertoire mit der einen oder
andern Bühnenzutat bereichert. Ulrich Burk-hardt: Unter allen
Schauspieldirektoren, die ich kenne, ist Albert R. Pasch der beste Koch. Und
unter allen Köchen, die ich kenne, ist er der beste Schauspieldirektor. Ich
füge hinzu: Wenn Franz und Paul von Schönthan je einen Striese leibhaftig
vor Augen hatten, dann muss dies Albert R. Pasch gewesen sein. Von einem
Mann, der als Kind bei Joachim Ringelnatz auf dem Schoße saß, wäre das auch
nicht anders zu erwarten gewesen.
Die Zweifel des alten Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) waren wohl
begründet, die er fünf Tage vor seinem Tod, am 22. März 1832, in einem Brief
an Alexander von Humboldt (1769-1859), der um Einblick in das Manuskript des
zweiten Faust-Teils gebeten hatte, schrieb, nämlich, die unmittelbare
Gegenwart komme ihm wirklich so absurd und konfus an, daß ich mich
überzeuge, meine redlichen, lange verfolgten Bemühungen um dieses seltsame
Gebäu würden schlecht belohnt und an den Strand getrieben, wie ein Wrack in
Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt der den Alltag belastenden
verwirrenden Kleinlichkeiten zunächst überschüttet werden.
So erscheint der nach mehr als fünfjähriger Arbeit 1831 vollendete zweite
Teil der Faust-Tragödie, vom Autor zunächst eingesiegelt in ein bergendes
Konvolut, erst nach seinem Tode. Wie sich zeigte, waren die Bedenken des
83-jährigen Goethe begründet. Die seit nunmehr 165 Jahren anhaltenden
philologischen Bemühungen um diese aus dem gewaltigen Lebenswerk heraus
verfolgten, in einen verwirrenden Anspielungsteppich verwobenen Fäden setzen
sich fort, jedes für gelöst gehaltene Rätsel öffnet den Zugang zu fünf
neuen, so dass des kindlichen Staunens kein Ende sein wird, solange es
Theater und Bühne gibt.
Albert R. Pasch hat das Opus magnum rigoros zusammengestrichen. Die bei
seiner zur Gänze entfalteten Sprachwelt nötigen zehn Stunden sind so auf
drei minimiert. Das bedeutet Konzentration auf einen interessierenden
Aspekt, und der zielt auf Faust selbst, auf das sich in der Welt bewegende
Ich, das selbstbewusste Verfolgen des individuellen Strebens, dessen er sich
bis zu seinem Ende nach seinem Maß immer bemüht. So wird der Versuch
unternommen, den ideellen Ansatz aus Faust, der Tragödie erster Teil - den
Fritz Bennewitz im Vorjahr zu inszenieren begann und den Albert R. Pasch
dankenswerterweise beendete, weil der Weimarer Regisseur unter der Arbeit
verstarb - auch im zweiten Teil fortzusetzen. Die inhaltlichen Konzepte
allerdings sind so grundverschieden, dass zu Beginn des zweiten Teil-Stücks
die Irritation größer ist als das Staunen über ein ins Kitschige geratenes
Einstiegstableau.
Fritz Bennewitz hatte versucht, seine über viele DDR-Jahre gewachsene
Faust-Deutung in einem mutigen Gewaltakt rigoros zurückzuznehmen; er
verweigerte der Gegenwart den Optimismus der früheren Jahre. Immerhin ging
es da auch um einen Faust, von dem Walter Ulbricht 1958 auf dem III.
Kongress des Nationalrats der Nationalen Front gesprochen hatte: Wenn ihr
wissen wollt, wie der Weg vorwärts geht, dann lest Goethes ´Faust´ und Marx´
´Kommunistisches Manifest´! Dann wisst ihr, wie es weitergeht.
Der zweite Teil nun versucht sich im direkten Anschluss, die Reminiszenz der
Kerkerszene steht dafür. Doch konnte der Bruch nicht deutlicher sein: Die
gleich zu Beginn sich zur Welt öffnende Weit- und Tiefsicht der Hauptfigur
wird im Bild von des bunten Bogens Wechseldauer wörtlich genommen und
verleitete den Regisseur zu der Annahme, er müsse den aus der
Gretchentragödie her-übergewechselten Titelhelden inmitten eines poppigen
Heiligenscheins von der Art einer antikonzeptionellen Medikamentenreklame
neugeboren erstehen lassen.
Hans-Joachim Rodewald, der mit fortgreifendem Text an darstellerischer
Sicherheit gewinnt, war, wie dies jedem andern Schauspieler auch ergangen
wäre, in diesen Eingangspassagen ziemlich hilflos. Wie auch Ulrich Kunze
übrigens, der seinen richtigen Mephisto-Touch auch erst nach längerer
Warmlaufzeit gewinnt. Mit der Investition einiger Gran Gehirnschmalz mehr,
eines genaueren Strichs gleich zu Beginn und mit mehr Zutrauen in den Sinn
des sezierten Textes hätten die Theaterleute dem Publikum weiterhelfen
können, damit es angesichts der zahlreich erscheinenden Figuren und ihrer
verschlüsselten Deutungen in dieser Inszenierung schneller Tritt fasse.
Wunderbare Szenen-Ideen veredeln den Verlauf der Vorstellung zunehmend: der
Kaiserhof in der Puppenkiste, der strahlende Elefant, die sehr dezente
klassische Walpurgisnacht mit dem putzig-zappeligen Chiron und den
entnervten hand(lungs)losen Philosophen, die gediegen schönen Helena-Szenen
und so weiter. Auch der Schluss-Gag, als der Herr (bekannt aus dem Prolog
vor dem ersten Teil, der mit der Wette: Ein guter Mensch in seinem dunklen
Drange, - Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.) nach seiner
eigenwilligen, sonst einem Engel vorbehaltenen Verkündigung, dass das edle
Glied der Geisterwelt vom Bösen gerettet sei, anwesend bleibt und Mephisto
die Gelegenheit beim Schopfe packt, um ihn mit: Da du, oh Herr, dich einmal
wieder nahst..., wieder von vorn zu provozieren sucht, ist, die Lacher
beim Publikum einkalkulierend, scheinbar gelungen, wenn der dramaturgische
Lapsus der direkten Anwesenheit des Herrn in seiner eigenen Show auch in
allerhöchstem Maße ungoethisch ist.
Bei der Umarbeitung des Textes im Interesse eines großen Publikums waren die
Streicher sehr um Einfühlsamkeit bemüht und um Förderung des Verständnisses
all der dunklen Wege und Unbilden, denen die Faustfigur ausgesetzt ist, mit
dem Erfolg, dass ihr leicht zu folgen sei: Die Strichfassung ist im
Programmheft dokumentiert, was die Zuschauer dankbar anerkennen dürften.
Aber dieser Eingängigkeits-Vorteil, der sich aus den Maximen der
Vorabendserienphilosophie auch leichthin erklären lässt, ist zwangsläufig
eingetauscht gegen ein grundlegendes Manko: Die aus weltgeschichtlichen
Wurzeln heraufdampfende Atmosphäre, die Faust in seinen teuflischen
Verstrickungen beim Wahrnehmen seiner menschlichen Verantwortung einem
zunehmenden Druck aussetzt, wird im Verlaufe dieser Inszenierung lediglich
angedeutet, jedoch nicht bewältigt. Hier wieder ist der Bruch zum ersten
Meininger Teil der Tragödie zu spüren, die vorgegebene Denk- und
Erlebnishöhe wird leider nicht gehalten. Der offenbar reichlich zur
Verfügung stehende theatralische Waberqualm macht auch in diesem Fall noch
keine Bedeutung.
Anhaltender freudig-freundlicher Premierenbeifall galt den beiden
Hauptdarstellern, einer dem griechisierenden Text ihrer Partie vollkommen
gewachsenen Marianne Thielmann als Helena und all den vielen in den
kleineren (undankbaren) Rollen mehrfach besetzten Darstellern, unter denen
Klaus Martin, Michael Kinkel, Michael Jeske und Jürgen Petereit besonders
hervorstechen. Das Bühnenbild der Inszenierung insgesamt ist stilistisch
nicht im Lot, wiewohl szenenweise passend-praktisch eingerichtet; Kaiserhof,
klassische Walpurgisnacht und Helena-Teil bestätigen, dass Christian Rinke
und Helge Ullmann in der Lage sind, der Phantasie freie Spielräume zu
schaffen. Viel trägt die sehr treffend gestaltete Maske zur Farbigkeit der
Szenen und zur Ausdruckskraft der Darsteller bei; allein die
Phorkyaden-Maske für Ulrich Kunze behindert sichtlich, plagt den Darsteller
unnötig über lange Strecken und die Zuschauer nicht minder, weil der Text in
der Maske verhallt und so die Ränge nicht erreicht.
Alles in Allem führen die Meininger Theaterleute mit ihrer Faust-II-Variante
achtbares Geschütz auf die Bühne. Gewiss, es könnte noch spielerischer, noch
lockerer, noch bedeutungstiefer und noch viel mehr goethischer über die
Bretter gezogen, gehoben, geschoben werden. Liebenswert ist das Tat
gewordene Selbstbewusstsein, es trotz all der vorauszusehenden Widrigkeiten
doch zu tun. Und wer weiß, vielleicht sehen wir eines Tages eine Meininger
Variante der Letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus oder Der Ring des
Nibelungen, für die Meininger Bühne bearbeitet von Richard Wagner. Solange
all dies möglich scheint, ist in dem Theater an der Werra ein lebendiger
Kern am Werke, der zur Freude seines treuen Publikums für manche
Überraschung gut ist. Darf ich den verwegensten unter den Kreativen
antragen, bei all der ausgebrochenen totalen Faust-Duselei über die Texte
von Nikolaus Lenau und Calderon de la Barca - sowie dem assoziativem Gemenge
hier und Figurenspiel da - hinaus, sich selbst samt ihrer angestammten
Theatergemeinde ein Sahnehäubchen zu gönnen und nun endlich mit dem
Nachdenken zur Inszenierung von Faust, der Tragödie dritter Teil zu
beginnen, jenem epochalen Werk in der Nachfolge Goethes, das uns Friedrich
Theodor Vischer alias Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Mystifizinsky
(1807-1887) geschenkt hat? (Ich bin das Lieschen, das am Brunnentrog -
Einst des Gespräches mit dem Gretchen pflog.) Das Werk des Dichters harrt
seiner Verlebendigung:
Lieschen: Ermanne dich, da steht der Hölle Sohn!
Komm zu dir! Auf, er packt dich schon!
Vertreib ihn mit Gebet,
Sonst wird´s zu spät!
Faust: Ach, lass mich fort, du bete nur und bleibe!
Ich breche auf und stürze in die Kneipe!
|
|
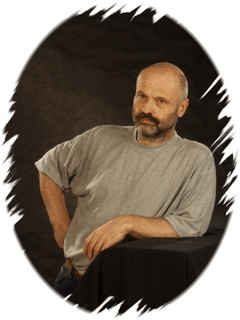 |
|